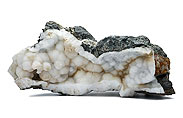Rheinland-Pfalz: Eifel / Juchem / Hunsrück / Donnersberg / Rheinbreitbach / Bad Ems / Taunus / Dernbach / Siegerland
Bellerberg / Mendig / Nickenich / Wannenköpfe / Emmelberg-Löhley / Arensberg / Schellkopf / Graulai u.a. / Erzgänge
Die Landschaft der Eifel besteht aus einem Schiefergebirge westlich des Rheins und nördlich der Mosel. Es finden sich auch Sedimente aus verschiedenen Erdzeitaltern, da das Meer früher bis in die Eifel reichte. Ein höher gelegener, südlicher Teil der Eifel wird als Vulkaneifel bezeichnet. Diese ist geprägt vom Vulkanismus, der vor 30 bis 40 Millionen Jahren seinen Höhepunkt hatte. 350 Vulkane sind in der Eifel bekannt. Der letzte Ausbruch des Laacher-See-Vulkans fand etwa 10900 Jahre vor Christus stattfand. Mit 16 km³ und dem Wert 6 auf dem Vulkanexplosivitätsindex stellt dieser Ausbruch ein sehr großer Ausbruch dar. Schon seit der Römerzeit werden in der Vulkaneifel Gesteine wie Bimstuff oder Basalt abgebaut.
Bellerberg und Hochsimmer bei Ettringen
Als Vulkaneifel bezeichnet man denjenigen Teil der Eifel, der vom Vulkanismus geprägt ist. Die Minerale kommen zwar in großer Vielzahl vor, die Größe der Kristalle liegt aber meistens nur im Millimeter-Bereich. Mindestens 300 Mineralarten sind nachgewiesen. Davon wurden 22 neu entdeckt, diese haben ihre Typlokalität in der Eifel. Der bekannte Steinbruch Caspar liegt am
Bellerberg östlich am Ortsrand von Ettringen. Die Minerale befinden sich entweder als Einschlüsse im Gestein oder sie wachsen in Hohlräumen, zum Beispiel
Braunit, kugeliger
Fluorit, würfelig bis tafelig gelber
Gehlenit,
Hydrocalumit,
Gismondin,
Jennit,
Magnetit,
Phlogopit, blauvioletter
Saphir, sowie verschiedene
Amphibole und
Pyroxene. Der
Mullit bildet weiße oder violette Kristallbüschel. Der
Zirkon vom Bellerberg ist begehrt, wenn er lachsfarben oder als „Bäumchen“ ausgebildet ist. Der
Titanit zeigt federartiges Wachstum, der
Topas kommt in nadeligen oder langprismatischen Kristallbüscheln vor. Der Ettringer Bellerberg ist Typlokalität für zahlreiche Minerale wie
Bellbergit,
Eifelit,
Ettringit,
Osumilith-(Mg) oder
Phillipsit. Speziell ist auch das Vorkommen einiger Minerale, die nur bei sehr hohen Temperaturen entstehen:
Cristobalit und Tridymit sind Quarz-Hochtemperaturmodifikationen, während der
Sanidin die entsprechende Modifikation des Feldspats darstellt. In den Steinbrüchen am
Hochsimmer westlich von Ettringen wird
Hochquarz in spitz zulaufenden Kriställchen gefunden. Der
Spinell kommt rosafarben transparent oder schwarz vor. Die oft farbig angelaufenen Oktaeder sind winzig klein.
Laacher See und Mendig: Steinbrüche In den Dellen und Rothenberg
Nicht weit von Ettringen liegt in nordöstlicher Richtung die Verbandsgemeinde
Mendig, die im Norden an den Laacher See grenzt. Der bekannteste Steinbruch von dort ist bei den Sammlern unter der Bezeichnung
In den Dellen bekannt (heute „Grube Zieglowski“). Aber auch in der Umgebung kann man fast überall Funde machen, zum Beispiel im Steinbruch
Rothenberg. Die begehrten Micromounts befinden sich in den Hohlräumen der vulkanischen Auswürflinge oder in den Kristallzwickeln anderer Mineralien. Sie sind oft nur mikroskopisch klein und gerade die seltenen Minerale werden oft übersehen. Das berühmteste Mineral von dort ist der saphirblaue
Haüyn, der nach Abbé Rene Just Haüy benannt ist. Die klaren Kristalle werden zu Edelsteinen verschliffen. Aus Mendig kommt auch der schönste
Titanit der Eifel, der dort honiggelbe Kristalle bildet. Der
Zirkon bildet kurz- bis langsäulige dipyramidale Kristalle oder sogar bäumchenartige Strukturen. Er erscheint meist weiß bis gelblich. Selten sitzen darauf – oder auch auf anderen Mineralen – winzige, oktaedrische Kristalle von roter oder rotoranger Farbe. Hierbei handelt es sich um ein Mineral aus der
Pyrochlor-Gruppe. Der unten abgebildete, dunkelrote Pyrochlorkristall ist noch mit Kugeln aus einem vulkanischen Glas überzogen. Selten zu finden sind das Zirkonoxid
Baddeleyit, der
Låvenit oder das Thoriummineral
Thorit. Auch Minerale der Seltenen Erden kommen vor, zum Beispiel
Fergusonit-(Y) oder
Allanit-(Ce).
Nickenicher Sattel und Nickenicher Weinberg
Östlich des Laacher Sees liegt
Nickenich. Dort sind zwei Fundstellen von Bedeutung: Der Steinbruch
Nickenicher Sattel (oder Eicher Sattel) liegt im Norden der Gemeinde, dort werden nadeliger
Aragonit, das Calciumhydroxid
Portlandit in sechseckig-tafeligen Prismen oder
Sodalith in winzigen, weißen Kristalle gefunden. Der
Nickenicher Weinberg (oder Sattelberg) liegt südlich von Nickenich. Bei diesem befindet sich eine große Grube, die im Tagebau betrieben wird und in dem Schlacken und Tuffmaterial abgebaut werden. Dort wird zum Beispiel bräunlicher Andradit, ein Mineral aus der
Granat-Gruppe, gefunden. Speziell sind die Wachstumsformen des
Hämatits, der auch nadel- bis bäumchenartig auftreten kann. Bei den gelborangen, nadelförmigen Kristallen, die sehr häufig auftreten, handelt es sich um ein unbestimmtes Mineral aus der
Amphibol-Supergruppe. Der
Rhönit bildet dunkelrote Kristalle, die nach dem triklinen System kristallisieren. Der
Cordierit ist an den rotbraunen Prismen zu erkennen. Der
Osumilith-(Mg) bildet blaue, prismatische Kristalle.
Steinbruch Wannenköpfe bei Ochtendung
Fährt man von Nickenich mehrere Kilometer südöstlich, gelangt man bei Ochtendung an den Steinbruch
Wannenköpfe. Dort wird der sehr seltene und bei Sammlern enorm begehrte
Jeremejewit gefunden. Das harte Aluminiumborat bildet – meist nur mikroskopische kleine – blaue bis fast farblose Kristallbüschel. Der
Topas kommt in farblosen, klaren Kristallen vor, die im langprismatischen bis nadeligen Habitus auftreten. Topas ist beim Steinbruch in den Basaltschlacken recht häufig anzutreffen, er ist gerne mit dem Feldspat
Sanidin vergesellschaftet. Das Magnesiumsilicat
Enstatit erscheint in gelborangen, durchscheinenden bis fast klaren Kristallen. Die Fundstelle liefert einmalig schöne Micromounts, zum Beispiel
Hämatit, der mit
Cristobalit überzuckert ist, oder auch
Fayalit,
Mullit,
Pseudobrookit,
Nephelin,
Pyroxene,
Rhönit und
Tridymit. Der
Rutil kommt in der Eifel eher selten vor, er bildet orangerote Nadeln.
Steinbrüche Löhley und Emmelberg bei Üdersdorf
Weiter westlich in der Eifel liegen die Steinbrüche
Löhley und
Emmelberg bei
Üdersdorf. Auch diese Steinbrüche sind sehr ergiebige Quelle für Eifelmineralien. Der sehr seltene
Lileyit ist nach dem Steinbruch Löhley benannt. Eine Rarität stellt auch das Barium-Titan-Mineral
Barytolamprophyllit dar, das braune, tafelige Kristalle ausbildet. Das Mischmineral
Melilith bildet ganze Rasen mit orangefarbenen Kristallen. Dazwischen findet sich auch nadeliger
Apatit oder klarer
Nephelin in hexagonalen Prismen. Das Titanmineral
Perowskit ist für seine skelettartigen Strukturen bekannt.
Pseudobrookit ist ebenfalls ein Titanmineral. Die schwarzen Kristalle sitzen oft auf dem
Feldspat Sanidin. Man erkennt sie – zur Unterscheidung von einem
Pyroxen – an dem hohen Metallglanz. Man findet zum Beispiel auch klaren, farblosen bis gelben
Leucit,
Roedderit,
Sillimanit oder auch das Kupfer-Vanadium-Mineral
Volborthit. Der Porricin ist eine nadelige Varietät des Minerals Aegirin-Augit, das zu den
Pyroxenen gehört.
Steinbruch Arensberg bei Hillesheim
Der aufgelassene Steinbruch
Arensberg bei Hillesheim liefert Zeolithe in prächtigen Aggregaten. Der
Natrolith kann mit den ebenfalls vorkommenden Mineralen
Mesolith und
Skolezit verwechselt werden. Der
Thomsonit-Ca kommt in Kristallen vor, die radialstrahlig oder kugelig angeordnet sein können. In den grauen Basaltdrusen sitzen die Kristalle häufig auf
Phillipsit-Ca.
Calcit bildet Skalenoeder oder auch andere Kristallformen wie in der Ausbildung „Kanonenspat“ oder Rhomboeder. Der rhomboedrische
Chabasit kann mit dem Calcit verwechselt werden. Von Arensberg stammt auch
Tobermorit in weißen Kugelaggregaten. Dieses Mineral ist schwer vom ähnlichen
Tacharanit zu unterscheiden, der sich an der Luft zu Tobermorit (und
Gyrolith) umwandelt und Mischkristalle bildet. Die hier abgebildeten Stücke verlassen sich auf die Zuordnung des 2020 verstorbenen Sammlers Max Kern, der diese Stücke selbst gesucht hat. Der
Thaumasit bildet feine Nadeln.
Gismondin-Ca erkennt man leicht an den typischen, fast klaren Kristallen.
Steinbruch Schellkopf bei Brenk
Im Phonolith-Steinbruch
Schellkopf bei Brenk
kommen die Minerale
Brenkit,
Nosean und Vandermeerscheit in der Typlokalität vor. Der
Gonnardit bildet kugelige oder büschelige Aggregate. Ein Gonnardit kann mit dem Paranatrolith verwechselt werden. Das Zeolith wandelt sich an der Luft unter Wasserabgabe zu „Tetranatrolith“ um, der heute nicht mehr als eigenständiges Mineral gilt und dem Gonnardit zugeordnet wird. Der
Calcit ist in klaren Skalenoedern zu finden. Der
Ettringit zeigt pseudohexagonale Kristalle. Es werden auch klare Kristalle von
Phillipsit-K oder
Phillipsit-Na gefunden. Weitere typische Minerale aus dem Steinbruch sind zum Beispiel
Analcim,
Chabasit-Ca,
Thaumasit,
Thomsonit-Ca oder
Zeophyllit.
Weitere Fundstellen in der Vulkaneifel
Der Steinbruch Stolz bei Hillesheim ist bei den Sammlern auch unter den Bezeichnungen „
Graulai“, „Graulei“ oder „Graulay“ bekannt. Von dort stammt sehr schöner
Alumohydrocalcit in weißen, büscheligen Aggregaten die auf anderen Mineralen sitzen. Auch nadeliger
Apatit, tafeliger
Batisit,
Gonnardit,
Nephelin,
Phillipsit,
Pyroxen,
Thomsonit oder
Perowskit in bizarren Skelettaggregaten werden neben den anderen typischen Eifelmineralen gefunden. Aus dem Steinbruch
Wartgesberg bei Strohn ist klarer
Osumilith-(Mg) oder grüner
Forsterit bekannt. Bei dem früher als „Kaersutit“ bezeichneten
Amphibol aus der Lavagrube am
Radersberg bei Dreis-Brück handelt es sich nach neueren Untersuchungen um Oxo-Magnesio-Hastingsit. Typisch sind die
Olivinbomben vom
Dreiser Weiher westlich von Dreis-Brück. Im Steinbruch
Hannebacher Ley bei Hannebach wird der seltene, gipsähnliche
Hannebachit in der Typlokalität gefunden.
Nördliche und südliche Eifel
Die Erzgänge im Norden von Rheinland-Pfalz zählen geographisch zur nördlichen Eifel, geologisch grenzt das Gebiet aber schon an die Erzgänge in
Nordrhein-Westfalen. Die ehemalige
Grube Gertrud bei
Antweiler liegt noch in Rheinland-Pfalz, dort wurden Kupferminerale wie
Chalkophyllit oder
Malachit gefunden. Die
Grube Hoffnung bei Ahrbrück ist für
Aragonit in der Varietät „Eisenblüte“ bekannt. Die
Grube Dorothea im Landkreis Ahrweiler ist bekannt für schöne Paragenesen aus
Galenit,
Chalkopyrit,
Siderit und
Sphalerit auf
Quarz. Aus
Bleialf bei Prüm stammen Bleierze wie
Pyromorphit oder tafeliger
Cerussit. Die ehemalige Bleierzmine ist als Besucherbergwerk eingerichtet.
Klausen ist eine Gemeinde im Landkreis Bernkastell-Wittlich, der zur südlichen Eifel zählt. Von dort kommt schöner Bergkristall.
Hinweis: Es werden nicht alle Minerale einer Fundstelle aufgezählt, sondern nur die bekanntesten.
































 Nosean
Nosean Nephelin, Apatit
Nephelin, Apatit

















 Chabasit
Chabasit