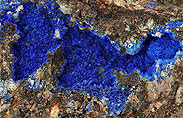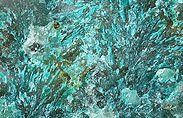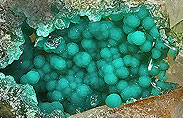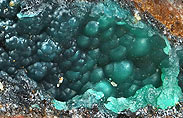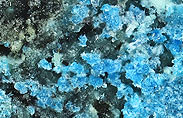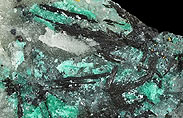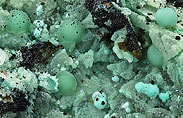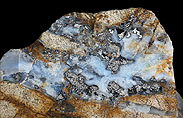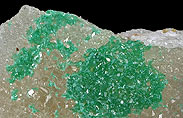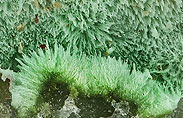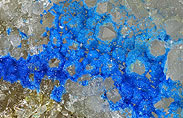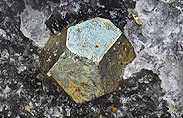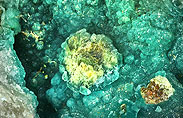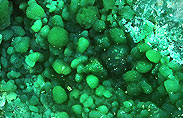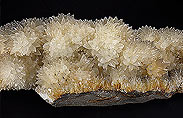Schwarzwald Nord/Mitte: Käfersteige / Neubulach / Freudenstadt / Silberbrünnle / Wildschapbachtal / Hechtsberg / Ludwig / Segen Gottes / Artenberg / Ohlsbach
Schwarzwald Mitte/Süd: Gremmelsbach / Schweighausen / Todtnau / Menzenschwand / St. Ulrich / Sulzburg / Schlächtenhaus / Grimmelshofen
Der Schwarzwald befindet sich östlich des Oberrheingrabens, er ist wie die Vogesen durch Emporhebung als Folge der Absenkung des Oberrheingrabens entstanden. Die ursprünglichen Sedimente wurden abgetragen, so dass die Erzkörper wieder weit bis an die Oberfläche reichen. Das Gestein ist überwiegend aus Gneis aufgebaut.
Grube Käfersteige
Südöstlich von Pforzheim bei Würm liegt die Grube Käfersteige. Sie besitzt eine der größten Flussspat-Lagerstätten Europas. Der
Fluoritgang enthält auch
Baryt und vor allem viel Quarz. Der senkrecht stehende Erzgang wurde bis zu einer Tiefe von 300 Metern abgebaut. Der kommerzielle Betrieb begann 1935 und endete im Jahr 1996. Beim alten Stollenmundloch sieht man heute noch Schienenreste, auf denen früher eine Dampflok einfahren konnte. Das neue Stollenmundloch liegt direkt an der L572 im Würmtal. Bei den Sammlern bekannt ist der nadelige
Bismuthinit, der auch mit
Bismutit vergesellschaftet sein kann. Die Grube lieferte den schönsten
Emplektit des Schwarzwaldes: Die Kristalle dieses Kupfer-Bismut-Erzes sind oft perfekt ausgebildet. Sie können auch den
Quarz oder den
Fluorit durchwachsen. Der
Malachit aus der Grube Käfersteige bildet manchmal schöne, büschelige Kristalle.
Neubulach
Auf den ehemaligen Halden bei Neubulach im Landkreis Calw fand man früher sehr schönen
Azurit. Besonders interessant sind die Fundstücke, bei denen der Azurit durch den Feuersetzbergbau zu schwarzem
Tenorit oxidiert ist. Diese Stufen sind für Neubulach absolut typisch. Der
Malachit kam in Büscheln, in kugelig-nierigen Aggregaten oder in Locken vor. Der blaugrüne bis grüne und nadelige
Mixit ist oft mit den beiden Kupfermineralen vergesellschaftet, er ähnelt dem
Agardit und auch dem
Zálesíit, die alle untereinander schwer zu unterscheiden sind. Verbreitet war auch
Olivenit in allen möglichen Wachstumsformen. Der prismatisch auftretende
Adamin kann farblos sein oder er ist durch Kupfer-Ionen grün gefärbt. Gefunden wurde auch der seltene
Tirolit, der radialstrahlige, blaugrüne Büschel ausbildet. Zu den Bismuterzen zählen der seltene
Beyerit und der vielgestaltige
Bismutit: Oft sitzt dieser in cremefarben Kugeln oder in hellgelben Sphärolithen auf anderen Mineralen wie Malachit. Er bildet auch grüne, nierig-kugelige Krusten. Manchmal tritt er pseudomorph nach stängeligem
Emplektit auf und erscheint dann fahlgrün. Das früher als „Annivit“ benannte Erz ist eine
Tetraedrit-Varietät mit Bismut-Ionen. Das früher als „Barioalumopharmakosiderit“ bezeichnete Mineral wurde diskreditiert: Bei den winzigen, gelben Würfeln handelt es sich um
Bariopharmakoalumit oder um
Bariopharmakosiderit. Als Minerale der Typlokalität anerkannt sind der
Arsenocrandallit, der extrem seltene Bulachit und der Sphaerobismoit.
Freudenstadt
Um Freudenstadt herum hat es zahlreiche alte Gruben, die vom mittelalterlichen Bergbau zeugen. Beim Freudenstädter Graben handelt es sich geologisch gesehen um eine Störungszone, die aus Buntsandstein besteht und über den Gneisen und Graniten liegt. Sie besteht überwiegend aus tertiären
Barytgängen, die auf älteren Quarzgängen mit Kupfer- und Bismuterzen sitzen. Früher wurden Eisen- und Kupfererze, aber auch Silbererze gefördert. Die ehemalige Grube
Heilige Drei Könige ist heute ein Besucherbergwerk. Die meisten Gruben liegen im Christophstal, die drei nebeneinander liegenden Gruben
Dorothea,
Haus Württemberg und
Neues Jahr sind Beispiele dafür. Die Firma Sachtleben fuhr in den 1990er-Jahren Material aus der Grube Dorothea in ihre Aufbereitungsanlage nach Wolfach. Daher kann sich dieses mit Material aus der
Grube Clara vermischt haben. In die Sammlungen gelangten vor allem Micromount-Stufen, größere Handstufen sind eher selten vorhanden.
Agardit-(La) kommt in der Grube Dorothea in der Typlokalität vor, das Mineral wurde dort erstmals bestimmt.
Bariopharmakosiderit und
Skorodit sind ähnlich gut ausgebildet wie in der Grube Clara.
Bismutit und
Emplektit sind typische Bismutminerale aus dem Erzgang. Eisenerze wie
Hämatit,
Goethit und
Siderit kommen ebenfalls vor. Gefunden werden neben vielen weiteren Mineralen auch
Arseniosiderit,
Brochantit,
Chalkophyllit,
Chrysokoll,
Cornwallit,
Cyanotrichit,
Cuprit,
Delafossit,
Gorceixit,
Kupfer gediegen,
Malachit,
Mixit,
Olivenit oder
Tetraedrit, jeweils in winzigen, aber meist schön ausgebildeten Kristallen.
Forbach, Hornberg
Es sind viele bedeutende Mineralfunde aus dem Schwarzwald dokumentiert. Den schönsten
Rauchquarz des Schwarzwaldes findet man bei
Forbach im Sasbachtal, einem Seitental des Murgtales.
Beryll ist sehr selten im Schwarzwald. Eine der wenigen Fundstellen liegt im Ortsteil Niederwasser der Stadt
Hornberg im Ortenaukreis.
Silberbrünnle
Die Grube
Silberbrünnle bei Gengenbach im Haigerachtal ist vor allem wegen dem
Pseudomalachit bekannt. Die alte Halde liegt mitten im Wald, die Stolleneingänge sind zugeschüttet. Sie war früher ein Eldorado für den Micromounter, zum Beispiel für
Agardit,
Bayldonit,
Brochantit,
Cerussit,
Chrysokoll,
Cornwallit,
Olivenit oder
Malachit. Der
Goethit tritt vielgestaltig auf, von gelb bis fast schwarz, als kugeliger bis nieriger Glaskopf, derb, in faserig-strahligen Aggregaten oder als Überzug auf anderen Mineralen. Der
Quarz ist manchmal mit
Hämatit vergesellschaftet oder er bildet die rote Varietät Eisenkiesel. Für Gengenbachit, Haigerachit und
Schapbachit ist die Grube Typlokalität. Minerale der Seltenen Erden wurden ebenfalls gefunden, zum Beispiel verschiedene
Rhabdophane oder der (dem Agardit ähnlichen)
Petersit-(Y).
Wildschapbachtal
Nördlich von Wolfach liegt die Ortschaft Schapbach im Wolfachtal. Das Wildschapbachtal zweigt vor Schapbach nach Nordwesten ab. Am bekanntesten sind die
Grube Friedrich Christian und die
Grube Herrensegen. Neben dem
Quarz und typischen Erzen wie
Baryt,
Fluorit oder
Galenit kommen von dort zum Beispiel auch
Anglesit,
Cerussit,
Langit oder
Linarit. Der
Pyromorphit aus der Grube Herrensegen bildet häufig kugelige Aggregate. Die Grube Friedrich Christian galt früher als Typlokalität für den
Schapbachit. Die in beiden genannten Gruben gefundenen grauschwarzen Nadeln im Quarz werden heute als Mischmineral aus Schapbachit mit Matildit angesehen, wobei der
Matildit überwiegt. Die alten Stufen
mit erkennbaren kubischen Kristallen haben sich als Mischung von Matildit mit Bleiglanz herausgestellt, so dass die Typlokalität diskreditiert wurde. Andere vorkommende Minerale sind neben weiteren
Annabergit,
Bismutit,
Brochantit,
Chrysokoll,
Malachit oder das Kupferoxid
Tenorit, das durch den Feuersetzbergbau aus Azurit oder Malachit entstehen kann. Bei dem natürlichen Aufschluss
Ausbiß, an dem der Hirschbach und der Wildschapbach
zusammenfließen, wurde das seltene Cermineral
Allanit-(Ce) gefunden.

Langit
Gr. Friedrich Christian
Hechtsberg
Zwischen Hausach und Haslach im Kinzigtal liegt der Steinbruch
Hechtsberg. In den Jahren 1966 und 1996 wurden dort ungewöhnliche Funde jeweils in einer einzelnen Zone gemacht. Zwischen grünblauem
Chrysokoll fanden sich kugelige Aggregate des Bismutsilicats
Eulytin. Die Kugeln sind durch den Chrysokoll gelbgrün bis blaugrün gefärbt. Manche zeigen einen sehr hohen Glanz. Nur selten erkennt man die tetraedrischen Kristalle, die die kugelartigen Aggregate aufbauen. Auf dem Chrysokoll oder sogar auf den Eulytinkugeln sitzen manchmal auch dunkelgrüne, kugelig-nierige Aggregate. Hierbei handelt es sich um das Kupfer-Bismut-Mineral
Namibit. Selten sitzt darauf auch
Bismutit in krustig-kugeligen, gelblichen Aggregaten. Dieser kann auch zu
Beyerit umgewandelt sein. Der extrem seltene
Hechtsbergit wurde im Steinbruch erstmals entdeckt. Dieses Bismutvanadat tritt in winzigen, braunen Kristallen auf. Neben einigen anderen Mineralen wurden auch
Epidot,
Erythrin oder
Malachit gefunden.
Grube Ludwig
Direkt hinter dem Steinbruch am Hechtsberg liegt die
Grube Ludwig mit vier ehemaligen Gängen und Halden im Adlersbachtal. Dort wurden früher Silbererze wie
Miargyrit abgebaut, der im
Quarz eingeschlossen ist. Der
Pyrit aus dem Friedrichgang weist sogar einen geringen Goldgehalt auf. Antimonminerale sind ebenfalls vertreten: Das Antimonerz
Stibnit (Antimonit)
kann teilweise in Stibikonit umgewandelt sein. Der
Semseyit ist recht häufig, allerdings sind kristalline Formen eher selten. Er ist im Quarz eingesprengt oder zeigt blättrige Aggregate. Weiter kommen neben einigen weiteren Erzen auch
Arsenopyrit, faseriger
Boulangerit und brauner
Sphalerit (Zinkblende) vor.
Grube Segen Gottes
Die
Grube Segen Gottes bei Schnellingen nördlich von Haslach im Kinzigtal ist heute ein Besucherbergwerk. Früher wurden dort Silbererze wie
Argentit,
Proustit oder
Pyrargyrit gefördert. Sichtbar ausgebildete Kristalle aus dieser Grube sind sehr selten, weil die Silbererze fein verteilt in den Erzgängen vorkommen. Besonders die Halden waren für Mineraliensammler interessant. Blei- und Zinkerze wie
Bleiglanz oder
Zinkblende waren häufig zu finden, ebenso
Chalkopyrit oder
Gips. Der
Fluorit bildet mit dem blättrigen
Baryt oder mit den genannten Erzen hübsche Kombinationen. Auch schön ausgebildeter oder verzwillingter
Markasit kommt aus dieser Grube. Der
Hämatit überzuckert in schwarzen Blättchen den
Quarz. Eine Spezialität ist
Schwefel, der winzige, klare Kristalle bildet. Sogar
Gold wurde gefunden.

Gips
Grube Segen Gottes
Steinbruch Artenberg
Im Steinbruch
Artenberg bei Steinach im Kinzigtal dürfen heute keine Mineralien mehr gesucht werden. Früher wurden dort ungewöhnlich schöne Stufen für den Micromounter in den Quarz-Calcit-Gängen gefunden. Der
Calcit kommt in vielen Formen und Farben vor. Er kann Phantome enthalten oder mit anderen Mineralen wie goldenem
Chalkopyrit, gelblichem
Dolomit, kugeligem
Hämatit oder grünem
Fluorit bewachsen sein. Der
Quarz tritt als klarer Bergkristall oder in der Varietät
Eisenkiesel auf. Diese ist manchmal mit dem weißen Eisenaluminiumsulfat
Halotrichtit oder auch mit dem goldgelben Eisenhydroxidsulfat
Copiapit vergesellschaftet. Auch der Calcit kann durch Eisenoxid-Einschlüsse orangerot erscheinen. Erze wie
Bleiglanz,
Boulangerit,
Bournonit,
Malachit,
Markasit,
Molybdänit,
Pyrit,
Pyrrhotin,
Tetraedrit oder
Zinkblende bilden meist nur sehr kleine Kristalle. Aus dem Steinbruch stammen auch Titanminerale wie
Anatas,
Brookit,
Rutil und
Titanit.
Wenzel, Fortuna, Einbachtal, Roßgrabeneck
Berühmt ist auch der
Dyskrasit in seiner Typlokalität aus der
Grube Wenzel. Das ehemalige Silberbergwerk bei Oberwolfach ist heute ein Besucherbergwerk. Aus der
Grube Fortuna im Gelbachtal stammt orangegelber
Stolzit. Das
Einbachtal mit der
Grube Erzengel Gabriel bei Hausach ist für farbstarken Fluorit bekannt. Am
Roßgrabeneck bei Zell am Harmersbach gibt es im Wald in den Quarzgängen schwarzen
Schörl und
Wolframit. Der schwarze Turmalin kann mit weißem
Fluor-Apatit besetzt sein.
Ohlsbach, Silbereckle
Ohlsbach liegt ein paar Kilometer südwestlich von Offenburg. Der
Fluor-Apatit mit seinen strahligen Aggregaten aus dem Steinbruch Riesenwald nördlich von Ohlsbach zeigt bemerkenswerte Wachstumsformen, ebenso der violette
Fluorit mit seinen Phantomzeichnungen. Auf den Halden im Wald der ehemaligen Grube
Silbereckle bei Lahr konnte man früher weißen
Köttigit finden.
Gremmelsbach
Weltberühmt ist der Stollen „Zum Pyrolusit“ beim Triberger Ortsteil
Gremmelsbach. Von dort stammt aus dem Triberger Granit
Pyrolusit, der pseudomorph nach
Manganit auftritt und wohl in jeder Mineraliensammlung vertreten ist. Der Pyrolusit kann mit
Baryt oder mit
Quarz vergesellschaftet sein. Das Manganerz
Braunit kommt in kleinen, schwarzen Oktaedern vor. Sehr selten ist das aus Manganoxalat-Dihydrat bestehende, organische Mineral
Lindbergit (früher in Gremmelsbach fälschlicherweise „Humboldtin“ genannt), das in weißen Nadeln auf dem Pyrolusit wachsen kann. Bei den schwarzen, traubigen Aggregaten, die in den Sammlungen mit
Psilomelan beschriftet sind, handelt es sich um ein nicht näher bestimmtes Mischmineral mit verschiedenen Manganoxiden. Es kann sich dabei um
Hausmannit handeln.
Schweighausen
Die Gegend um Schweighausen im Schuttertal ist für schönen
Achat bekannt, der zum Beispiel im ehemaligen
Steinbruch am Geisberg gefunden wurde. Auch kryptokristalliner Chalcedon in der roten Varietät Karneol kommt am Geisberg vor. Südlich von Schweighausen befindet sich der Rhyolith-Steinbruch
Hünersedel. Der Name hat sich so eingebürgert, er ist aber etwas irreführend: Der Steinbruch liegt nicht am Berg Hünersedel, sondern westlich des Heubergs. Die Paragenesen und Einschlussvarietäten von verkieseltem
Quarz mit Eisenoxiden sind dort einmalig und unverkennbar. Die Quarzkristalle zeigen manchmal auch Zepterwachstum oder Phantome. Der schwarze bis rote
Hämatit kann zu rotem
Lepidokrokit verwittert sein. Auch das gelbe Eisenerz
Siderit tritt auf. Der schwarze
Goethit kommt nadelig oder als nierenförmiger „Glaskopf“ vor. Eine Spezialität ist das Aluminiumsilicat
Nakrit, das in den Hohlräumen auskristallisiert und sechsseitige, tafelige Prismen bildet. Eher selten zu finden sind schöne Kristalle des Wolframerzes
Scheelit.
Revier Todtnau, Feldberg und Umgebung
Der
Feldberg ist mit 1493 Höhenmeter der höchste Gipfel des Schwarzwaldes. Schöner
Fluorit wurde zum Beispiel an den
Hasenmatten bei Todtnau gefunden. Die
Grube Maus mit den alten Halden am Maustobel befindet sich rechts der Straße am Ortsausgang von Todtnau Richtung Feldberg. Der
Baryt kann mit einer sekundären Generation aus
Dolomit besetzt sein, darauf befindet sich eine dritte Generation mit
Calcit (siehe Fotos). Aus der ehemaligen
Grube St. Anna bei Fahl stammen gelber bis zonar blauer
Fluorit und auch wunderschöner
Bleiglanz in kleinen Kristallen.
Calcit und
Dolomit sind häufig mit
Pyrit überzuckert. Ähnliche Paragenesen kommen aus der alten Lagerstätte
Brandenberg. Von dort sind schöne Kombinationen von
Baryt,
Fluorit oder
Calcit mit
Dolomit,
Pyrit und
Quarz bekannt. Der Calcit tritt häufig in der Varietät Kanonenspat auf. Der Fluorit-Baryt-Gang der
Grube Baumhalde liegt oberhalb von Fahl am
Silberberg. Die abgebildeten Minerale
Malachit oder
Rhabdophan-(Ce) sind zwei Beispiele aus dieser Lokalität. Typisch für das Revier Todtnau ist auch bläulicher
Chalcedon, der gerne mit Bleiglanz vergesellschaftet ist. Aus dem
Kammendobel auf der Westseite des Feldbergs Richtung St. Wilhelm stammt der schönste
Pyromorphit aus der Gegend. Das Mineral wurde auch auf den
Ratscherthalden bei Todtnauberg und auf den Halden der ehemaligen
Grube Rotenbach unterhalb der Todtnauer Hütte gefunden. Bei
Lenzkirch zwischen dem Titisee und dem Schluchsee gibt es einen natürlichen Aufschluss im Ortsteil Saig, in dem gut auskristallisierter
Hämatit gefunden wird.
Menzenschwand
Im
Krunkelbachtal südlich des Feldbergs liegt bei
Menzenschwand eine der wenigen Uranerzlagerstätten in Mitteleuropa. Im Zeitraum von 1960 bis 1991 baute man ca. 100'000 Tonnen Uranerze ab. Der Abbau war zwischenzeitlich aufgrund von Protesten der Anwohner und der Umweltschützer unterbrochen. Der Abtransport der Erze erfolgte mit LKWs zum Bahnhof Seebrugg am Schluchsee. In den 1970er-Jahren standen dort frei zugängliche Eisenbahnwaggons, die mit Uranerzen gefüllt waren. Heute ist die ehemalige Halde im Krunkelbachtal renaturiert. Aus Menzenschwand stammen viele Uranminerale. Am bekanntesten sind die schwarze
Pechblende und der grüngelbe
Uranocircit, welcher im UV-Licht eine starke grüne Fluoreszenz aufweist. Der
Arsenuranospathit bildet gelbe, blättrige Kristalle mit tafeligem bis säuligem Habitus. Es kommen viele weitere Uranminerale vor, zum Beispiel
Autunit,
Fourmarierit,
Heinrichit,
Kasolit,
Phosphuranylit,
Rutherfordin,
Schoepit, Studtit,
Torbernit oder
Uranophan. Der
Uranopilit ist auch unter der Bezeichnung „Uranocker“ bekannt. Für Arsenovanmeerscheit, Heisenbergit, Joliotit, Nielsbohrit, Uranosilit und Uranotungstit ist Menzenschwand Typlokalität. Der
Quarz kommt aufgrund der radioaktiven Strahlung als sehr dunkler Rauchquarz vor.
St. Ulrich
Zur Gemeinde Bollschweil südlich von Freiburg gehört das Kloster St. Ulrich. In der Umgebung ist der Bergbau seit dem Mittelalter dokumentiert, zum Beispiel im Revier
Birkenberg südwestlich von St. Ulrich. Ein Bergbaupfad erinnert daran. Dort findet man neben den typischen Antimonerzen wie
Stibnit und sein gelbliches Umwandlungsprodukt
Stibiconit auch
Agardit,
Azurit,
Beudantit,
Malachit,
Fahlerze, sowie Silbererze wie
Proustit und
Pyrargyrit. Weiter oben Richtung Schauinsland in südöstlicher Richtung liegen die alten Halden im
Gründenwald. Das bekannteste Mineral von dort ist der nadelförmige
Berthierit. Dieses Eisen-Antimon-Sulfid läuft gerne farbig an. Das Silber-Antimon-Sulfid
Miargyrit erscheint dagegen blockiger. Der rötliche
Metastibnit entsteht durch eine Umwandlung aus dem Berthierit. Seltener ist das Antimonoxid
Valentinit.
Pyrit und
Arsenopyrit bilden in Gründenwald winzige Kristalle, ebenso
Schwefel der meist auf den Antimonmineralen oder auf dem
Quarz sitzt.
Revier Sulzburg
Das Revier Sulzburg liegt südlich des
Münstertals im Sulzbachtal. Im Stadtzentrum von Sulzburg befindet sich die ehemalige, evangelische Pfarrkirche, in der von 1982 bis 2023 das Landesbergbaumuseum untergebracht war. Schon in der Jungsteinzeit vor 7000 Jahren wurde in Sulzburg das Eisenerz
Hämatit abgebaut. Das Gebiet in der weiteren Umgebung weist verschiedene Typen von Lagerstätten auf. Das ehemalige Bergwerk
Schweizergrund ist auch als „Antimongrube“ bekannt. Der antimonhaltige Quarzgang weist Vererzungen auf. Der
Antimonit (=Stibnit) kann unter Abgabe von
Schwefel zu verschiedenen anderen Antimonmineralen oxidiert sein, zum Beispiel zu
Valentinit oder
Stibiconit. Der
Boulangerit tritt haarfömig in Quarzdrusen auf. Die
Pfarrhöhle und das
Holderpfadgebiet führen seltenere Minerale der Antimon-Paragenese, zum Beispiel
Plagionit oder
Zinkenit. Der gelbe
Oxyplumboroméit tritt pseudomorph nach Zinkenit auf.
Sericit ist eine feinblättrige Muskovitvarietät. Aus der
Schnellinggrube stammen
Meneghinit und
Parasymplesit.
Der eventuell schon seit der Römerzeit betriebene
Riestergang führt Buntmetallerze wie
Malachit,
Pyromorphit oder
Sphalerit. Die
Kobaltgrube ist auch unter dem Namen „Segen Gottes“ bekannt.
Erythrin und
Kobaltkoritnigit sind nicht so häufig, das abbauwürdige Kobalterz ist eine Mischung aus
Löllingit,
Rammelsbergit und
Safflorit. In der prähistorischen Rötelgrube am
Hämatitabbau ist der
Hämatit mit
Quarz vergesellschaftet. Ein weiteres bekanntes Mineral aus Sulzburg ist der
Amethyst, der schöne Strukturen zeigt, wenn er geschliffen wird.
Gips wird im
Fliederbachstollen am Dreispitz gefunden. Er stammt aus einem kleinen Amethystquarzgang in Richtung
Rammelsbacher Sattel. Die Stücke erinnern an den Amethyst aus Geyer im Erzgebirge. Weiter südlich von Sulzburg gelangt man zum
Revier Badenweiler.

Gips
Fliederbachstollen
Schlächtenhaus
Ganz im Süden des Schwarzwaldes liegt die Gemeinde Steinen mit dem fünf Kilometer nördlich davon gelegenen Ortsteil
Schlächtenhaus. Am Heidelweg nach Endenburg gibt es eine Haarnadelkurve. Dort fand der Autor zusammen mit seinem Cousin schon als Jugendlicher in den 1970er-Jahren den blauen Azurit am Straßenrand.
Im Gebiet existieren Spuren eines mittelalterlichen Bergbaus. Die Kupfererz-Lagerstätte wurde aber erst 1931 unter der Bezeichnung
Kupfergrube Heidelwerk erschlossen. Die beiden Stollenmundlöcher und die Haldenreste sind heute überwachsen. In den Sammlungen ist oft nur „Schlächtenhaus“ oder gelegentlich auch „Endenburg“ angegeben. In den 1990er-Jahren wurde der Aufschluss erneut durch den Kanalbau an der Straße freigelegt. Neben dem
Azurit treten einige Kupfer-, Blei- oder Arsenminerale auf, zum Beispiel
Chrysokoll,
Cornwallit,
Cuprit,
Langit,
Malachit,
Mimetesit,
Olivenit,
Strashimirit,
Tetraedrit oder
Tirolit. Auch sehr schöner
Konichalcit wurde gefunden.
Grimmelshofen, Wutachtal
Der Steinbruch bei
Grimmelshofen liegt in einem Seitental des Wutachtals oberhalb der Ortschaft an der B 314. Noch heute wird dort Kalk abgebaut, er ist für seine
Calcite berühmt. Dort wurden große Skalenoeder bis 20 Zentimeter Länge gefunden. Die Aggregate mit reich besetzten Calcit-Igeln stammen teilweise noch aus alten Funden, die beim Bau der Straße oder auch beim Bau der Eisenbahn nach Blumberg mit ihren zahlreichen Kehrtunneln ans Tageslicht kamen. Das zweite Foto zeigt eine 30 Zentimeter breite Museumsstufe. Das Gipsbergwerk
Schleitheim im Wutachtal liegt schon in der Schweiz, direkt an der Grenze zu Deutschland im Kanton Schaffhausen. Von dort stammt schöner
Fasergips.
Kaiserstuhl
Oberrheingraben
Der Oberrheingraben zwischen Basel und Frankfurt am Main entstand durch Absenkung im Laufe der letzten 50 Millionen Jahre. In früheren Erdzeitaltern reichte das Meer bis in diese Gegend, heute prägt der Rhein das Landschaftsbild. Durch Ablagerungen entstanden einst die Salzlagerstätten. Die Salinen Schweizerhalle bei Basel fördern noch heute Sole aus alten Salzlagerstätten. Das
Kalisalzbergwerk
Buggingen war noch bis 1973 in Betrieb. Bei Buggingen sind noch Reste der alten Abraumhalde zu sehen, die auch „Monte Kalino“ genannt wird. Die Minerale
Carnallit,
Halit oder
Sylvin sind typische Vertreter aus dieser Lokalität. Sehr speziell sind auch die Paragenesen mit klaren, langgezogenen
Natrolithkristallen, blockigem
Anhydrit und dem Granatmineral
Andradit.
In direkter Nachbarschaft zum
Kaiserstuhl befindet sich der
Tuniberg, der sich geologisch zwar vom Kaiserstuhl unterscheidet, aber über eine Verwerfung verbunden ist. Die Kalksteinerhebung ragt nur wenig über den Oberrheingraben, sie ist von Löss und Lehm überzogen. Durch die hohe Speicherfähigkeit des Kalks für Wasser und aufgrund der Lage mit viel Sonne im Jahr ist der Tuniberg ein ideales Anbaugebiet für Reben. Im großen Steinbruch bei
Merdingen kommt kristallisierter
Calcit vor, der unverwechselbar ist: Er ist oft durch den gelblichen Löss leicht verschmutzt, dunkle Eisensalze im Innern erzeugen Phantome.
Dinkelberg
Der Dinkelberg ist ein kleines Gebirge ganz im Südwesten Deutschlands. Es wird umrahmt durch die Städte Lörrach, Schopfheim, Wehr und Rheinfelden. Der Dinkelberg unterscheidet sich geologisch vom Schwarzwald und vom Schweizer Jura. Das Gestein stammt überwiegend aus dem Mitteltrias, der fossilienreiche Muschelkalk ist vorherrschend. Beim Autobahnbau der A98 fanden um 1980 am
Homburger Wald bei Lörrach große Grabarbeiten statt. Im Aushub fand man zahlreiche Versteinerungen, darunter Ammoniten, Brachiopoden, Muscheln und Trochitenkalk, der reich mit Seeliliengliedern durchsetzt ist. Die Drusen des Gesteins und auch die Hohlräume der versteinerten Ammoniten sind mit kristallinem
Calcit bewachsen. Beim Bau der Häuser vor 1980 am angrenzenden
Hühnerberg in Lörrach gab es ebenfalls hervorragende Fossilfunde, zum Beispiel versteinerte Hahnenkammaustern
oder riesige Belemniten.
Hegau
Die Hegauvulkane liegen südlich der Schwäbischen Alb zwischen der Donau und dem Bodensee. Am bekanntesten ist der
Hohentwiel bei Singen. Dort wurde der
Natrolith erstmals gefunden und durch Martin Heinrich Klaproth 1803 beschrieben. Der Natrolith bildet in der Typlokalität zonar weiß und gelb gefärbte Sonnen, die im graubraunen Phonolith vorkommen. In den Hohlräumen des vulkanischen Gesteins ist der Natrolith auch nadelig ausgebildet. Im 19. Jahrhundert wurde der Phonolith abgebaut, heute herrscht am Hohentwiel striktes Sammelverbot. Vereinzelt sind einzigartige Schmucksteine in Sammlungen vertreten, die das Sonnenmuster im geschliffenen Phonolith zeigen. Das aus einem Basaltblock bestehende
Höwenegg ist der nördlichste der ehemaligen Hegauvulkane. Heute ist dort beim See und dem alten Steinbruch ein Naturschutzgebiet. Einmalig sind die Kombinationen von rhomboedrischem
Calcit mit nadeligem
Natrolith. Aus alten Funden stammen auch
Gips,
Magnetit,
Montmorillonit,
Tobermorit oder die typischen Zeolithe, wie sie im vulkanischen Gestein vorkommen, zum Beispiel
Chabasit,
Garronit-Ca,
Phillipsit,
Mesolith,
Skolezit,
Thomsonit-Ca, sowie
Amicit in der Typlokalität.
Schwäbische Alb
Die Schwäbische Alb im Südosten von Baden-Württemberg ist eine ehemalige Hochebene, die wie der Schweizer Jura hauptsächlich aus Jurakalk besteht und durch Erosion teilweise wieder abgetragen wurde. Die Schwäbische Alb wird von der Donau durchschnitten. Im Kalk findet man neben den Fossilien vor allem gut ausgebildeten
Calcit, zum Beispiel in den Steinbrüchen bei
Allmendingen oder am Kapellenberg bei
Schelklingen. Das Bohnerz ist ein
Brauneisenerz, es kann in kalk- und lehmhaltigen Erden oder in Kalkhöhlen entstehen, wenn lösliche Eisenverbindungen hinzukommen. Es eignet sich zur Gewinnung von Ockerpigmenten. Abgebaut wurde es zum Beispiel bei Sigmaringen oder Ulm. Eine ehemalige Bohnerzgrube ist auch die Wagnersgrube an der A7 nördlich von
Oggenhausen. Heute findet man dort ein Biotop, an dem man auf dem Erzweg von Heidenheim nach Oggenhausen vorbeikommt. Durch Verpressen von Kalkablagerungen mit eisenhaltigen Tonmineralien in den ehemaligen Meeren entstand Knollenkalk. Die Färbungen werden hauptsächlich durch
Hämatit verursacht. Aus einem aufgelassenen Steinbruch zwischen Oggenhausen und Staufen stammt gelber
Calcit in der Varietät „Honigspat“.
Dotternhausen liegt südlich von Balingen im Zollernalbkreis. Im Schwarzen Jura kommen neben den Fossilien auch Mineralien wie
Calcit oder knollen- bis kugelförmiger
Pyrit vor. Je nach Verkohlungsgrad sind bituminöse Gesteine zu finden, die aus fossilem Holz entstanden sind, zum Beispiel Gagat. Diese auch „Pechkohle“ genannte, schwarze Masse erkennt man am Glanz und an der geringen Dichte.
Pyrit im Ölschiefer gibt es auch an anderen Fundstellen auf der Schwäbischen Alb, zum Beispiel in
Ohmenhausen bei Reutlingen. Der rötlich glänzende
Pyrit aus einem Bachbett bei
Reichenbach in der Nähe von Aalen ist teilweise schon korrodiert.
Neckar
Etwa 15 Kilometer südlich von Heidelberg liegt
Wiesloch. Dort gab es früher zahlreiche Stollen und Erzgruben. Der vorhandene Muschelkalk wurde an dieser Stelle im Laufe der Zeit von Erzkörpern verdrängt, so dass auch Blei- und Zinkerze vorhanden waren. Aus alten Sammlungen stammen Stücke mit
Wurtzit,
Sphalerit und Galenit in Schalenblende. Die bekannten
Gipskristalle aus „Wiesloch“ stammen allerdings aus der seit den 1990er-Jahren geschlossenen Tongrube im Dämmelwald beim Kompostwerk. Im 30 Millionen Jahre alten Septarienton aus dem Oligozän fand man Gips-Schwimmer mit bis zu zehn Zentimeter Länge, die teilweise auch eine Sanduhrzeichnung aufweisen. Südlich des Odenwaldes befindet sich das vom Neckar geprägte Heilbronner Becken. Aus der
Tongrube Ilsfeld bei Heilbronn stammen die schönsten Kalkversinterungen aus Deutschland.
Hinweis: Es werden nicht alle Minerale einer Fundstelle aufgezählt, sondern nur die bekanntesten.