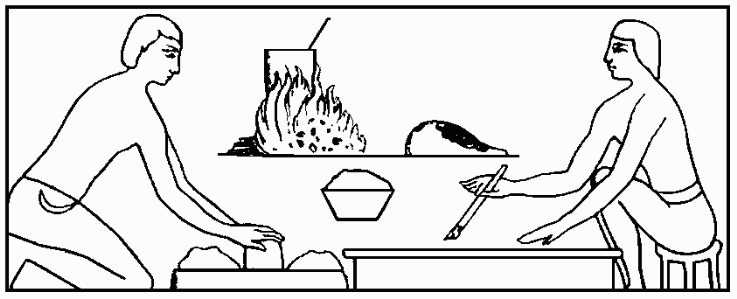| Man
kann die Pigmente nach verschiedenen Kriterien einteilen.
Anorganische Pigmente
bestehen aus farbigen Stoffen, die frei von Kohlenstoff-Verbindungen
sind. Bestimmte Pigmente wie Blei- oder Arsenpigmente sind stark
toxisch, diese dürfen heute nur noch eingeschränkt eingesetzt
werden, oder sie sind ganz verboten. Andere sind weniger toxisch und
werden häufig eingesetzt.
- Arsenpigmente: Auripigment, Realgar, Schweinfurtergrün
- Bleipigmente: Bleimennige, Bleizinngelb, Bleiweiß, Chromgelb, Neapelgelb
- Cadmiumpigmente:
Cadmiumgelb, Cadmiumrot, Cadmiumorange
- Cobaltpigmente:
Cobaltblau, Cobaltcölinblau, Cobalttürkis, Cobaltviolett, Rinmansgrün, Smalte
- Eisenpigmente: Gelber Ocker, Roter Ocker, Eisenoxidschwarz
- Kupferpigmente: Ägyptischblau, Azurit, Bremerblau, Grünspan, Malachit
- Manganpigmente: Manganblau, Manganschwarz, Manganviolett
Organische Pigmente
enthalten organische Kohlenstoff-Verbindungen, sie sind aus dem
Erdöl zugänglich. Man kann sie aufgrund ihres chemischen
Aufbaus unterscheiden:
- Azopigmente wie Brillantgelb oder Permanentrot enthalten mindestens eine Azogruppe (-N=N-).
- Polycyclische Pigmente wie
das Phthalocyaninblau oder das Heliogengrün sind aus ringförmigen Komplexverbindungen aufgebaut.
- Diketopyrrolopyrrol-Pigmente
(DPP) wie das "Ferrari-Rot" Pigment Red 254 basieren
auf der stickstoffhaltigen, heterocyclischen Verbindung Diketopyrrolopyrrol.
Pigmente lassen sich auch
aus Farbstoffen gewinnen. Hierbei werden die Farbstoffe auf Trägermaterialien
wie Tonerde aufgetragen. Beim Ausfällen des Farbstoffes zusammen mit
einem anorganischen Salz erhält man einen Farblack. Der so aus Krappwurzeln gewonnene Krapplack war früher ein
verbreitetes Farbmittel. Allerdings ist die Lichtechtheit der Farblacke nicht
besonders gut. Sie sind heute weitgehend durch die organischen Pigmente
abgelöst worden.
Farbmittel werden in einer international offiziellen Liste geführt, die von der Society of Dyers and Colourists in Bradford, England herausgegeben wird. Nach dem Generic Name folgt der Colour Index CI.
Pigmente mit dem gleichen Colour Index besitzen ein bestimmtes
chemisches Aufbauprinzip. Der Farbton und die exakte chemische
Zusammensetzung kann beim gleichen Colour Index aber variieren. Manche
Pigmente haben den gleichen Colour Index, aber einen unterschiedlichen
Generic Name:
Produktname: Ultramarinblau dunkel
Generic Name: PB29 (Pigment Blue 29)
Colour Index: CI 77007
CAS-Nummer: 57455-37-5
Produktname: Ultramarinviolett
Generic Name: PV15 (Pigment Violet 15)
Colour Index: CI 77007
CAS-Nummer: 12769-96-9
Die CAS-Nummer klassifiziert
das Farbmittel als Chemikalie. Dadurch ist eine Zuordnung zum möglichen
Gefahrenpotential möglich. Eine toxikologische und ökotoxikologische
Beurteilung der Pigmente ist von Bedeutung, da einige Pigmente toxisch
wirken oder umweltgefährlich sind. Dies gilt insbesondere für
kupfer-, blei- oder arsenhaltige Produkte.
Von weiterer Bedeutung ist die Lichtbeständigkeit oder Lichtechtheit eines Pigments. Nach den DIN-Normen DIN 54003 (Tageslicht, veraltet) und DIN 54004 (Xenonlicht, neu) der Wollskala gilt:
Lichtechtheit der Farbmittel nach der Wollskala
|
| Lichtechtheit |
Zuordnung |
| 8 |
hervorragend |
| 7 |
vorzüglich |
| 6 |
sehr gut |
| 5 |
gut |
| 4 |
ziemlich gut |
| 3 |
mäßig |
| 2 |
gering |
| 1 |
sehr gering |
|
| |
Zur Zuordnung
der Wollskala werden die Testproben mit acht Wollfäden verglichen,
die mit acht blauen Farbstoffen verschiedener Lichtechtheit
eingefärbt sind. Für moderne Künstlerfarben wird eine
Lichtechtheit von 7 bis 8 oder 8 verlangt. Im Vergleich dazu hat der
früher oft verwendete, rote Krapplack nur eine Lichtechtheit von 5
bis 6. Werden Farben lasierend aufgetragen, beispielsweise in der
Aquarelltechnik, ist die Lichtechtheit geringer. Beim Mischen von
Pigmenten und vor allem beim Zusatz von Weißpigmenten zu
organischen Farbmitteln kann die Lichtechtheit ebenfalls erheblich
vermindert werden. Pigmente verblassen unter dem Einfluss von
Sonnenlicht. Bei Leuchtstoffröhren ist der Anteil des austretenden
UV-Lichts erheblich geringer.
Bei der Wetterechtheit
geht es darum, wie beständig ein Pigment im Außenbereich unter
dem natürlichen Witterungseinfluss ist.
Die Benetzbarkeit gibt
an, wie gut sich ein Farbmittel mit einem Bindemittel vermischen lässt.
Anorganische Pigmente sind in der Regel gut mit Wasser benetzbar, während
sich organische Pigmente mit Wasser nur sehr schlecht benetzen lassen.
Organische Pigmente sind eher gut fettlöslich und wirken daher wasserabstoßend
(hydrophob).
Das Färbevermögen oder die Farbstärke
gibt an, wie fähig ein Pigment ist, einen anderen Stoff zu
färben oder (bei schwarzen Pigmenten) zu verdunkeln. Zur Bestimmung
kann man ein buntes oder schwarzes Pigment mit der zehnfachen Menge
Zinkweiß anreiben und vermalen. Tendenziell steigt das
Färbevermögen mit sinkender Korngröße. Es
hängt insgesamt aber vom chemischen Aufbau, von der
Kristallstruktur, von der Korngröße und vom
Agglomerationszustand, der Gesamtheit aller Oberflächen in den
Pigmentkörnern, ab. Bei weißen Pigmenten wie Titanweiß
spricht man dagegen vom Aufhellungsvermögen.
Das Deckvermögen oder die Deckkraft
bezeichnet die Fähigkeit, wie stark ein Pigment in einer Farbe
nach dem Trocknen einen Untergrund unsichtbar machen kann. Fehlt das
Deckvermögen, liegt Transparenz vor. Das Deckvermögen
hängt von der Teilchengröße des Pigments und vom
Verhältnis der Lichtbrechung zwischen Pigment und Bindemittel ab:
Je größer der Unterschied der Brechungsindizes n, umso
besser ist das Deckvermögen. Bei Lasuren werden Farben bewusst so
dünn aufgetragen, dass der Untergrund durchscheint. Bei bestimmten
Farbmitteln wie Krapplack ist eine schlechte Deckkraft und dafür
hohe Transparenz erwünscht. Die Kenndaten der Pigmente in der
Tabelle geben ungefähre Werte wieder. Sie beruhen auch auf eigenen
Erfahrungen des Autors.
| Kenndaten ausgewählter
Pigmente |
|
|
| |
|