Lage
Der Kaiserstuhl ist ein kleines, vulkanisches Gebirge am Oberrhein westlich von Freiburg neben dem Tuniberg zwischen Breisach, Sasbach, Endingen, Riegel, Bahlingen, Eichstetten, Bötzingen und Ihringen. Die zentral gelegene Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl umfasst neun ehemalige Ortschaften, darunter auch Achkarren, Burkheim, Oberbergen, Oberrotweil, Unterrotweil und Schelingen. Der Totenkopf mit seinen beiden Gipfelkuppen ist mit 556,8 Höhenmeter der höchste Berg, der darauf stehende Fernmeldeturm ist weithin sichtbar. Der Limberg bei Sasbach grenzt direkt an den Altrhein, dort befindet sich auch der Rheinübergang nach Frankreich. Ein Übergang zu Fuß und für das Fahrrad über den Altrhein ist seit 2023 auf dem neuen Stauwehr vor dem Humberg bei der Burg Sponeck vorhanden. Der nächste Übergang weiter südlich befindet sich bei Breisach am Rhein. Der Kaiserstuhl ist überwiegend von den Reben und dem Weinbau geprägt. Im Löss können Bienenfresser ihre Höhlen graben. Auf dem Trockenrasen am Badberg über dem Badloch und im Lilienthal bei Ihringen wachsen seltene Orchideenarten.
Geschichte
Das Kaiserstuhl-Vulkangebiet im Zentrum des heutigen Gebirges entstand im Miozän vor ungefähr 18 bis 15 Millionen Jahren an einer Schwächezone im Oberrheingraben. Die überwiegend im nordöstlichen Teil noch zu sehenden Sedimentgesteine sind älter und entstanden wie auch der benachbarte Tuniberg bereits davor und bilden den Sockel. Darum herum befinden sich Hügel, die aus Ergussgesteinen und Tuffen bestehen, sie sind mit einer dicken Schicht aus Löss bedeckt.
Den ersten Weinbau betrieben bereits die Römer, noch heute wird der Kaiserstuhl als die „Toskana Deutschlands“ bezeichnet. Ihringen gilt als eine der wärmsten Ortschaften in Deutschland. Der ursprüngliche Name „Königstuhl“ wurde wahrscheinlich von König Otto III. geprägt, der am 22. Dezember 994 in Leiselheim (heute Ortsteil von Sasbach) einen Gerichtstag abhielt. Gleichzeitig soll der Berg Totenkopf seinen Namen erhalten haben, weil Otto dort die Verurteilten hinrichten ließ. Die Verwendung des Namens Kaiserstuhl ist erst seit 1304 historisch belegt.
Fohberg bei Bötzingen
Der größte und zugleich noch aktive Steinbruch des Kaiserstuhls am Fohberg bei Bötzingen ist – benannt nach dem Besitzer – auch als „Steinbruch Hauri" bekannt. Der vorhandene Phonolith enthält eine Grundmasse aus Alkalifeldspat, Aegirin-Augit, Melanit oder Wollastonit. Heute dürfen nur noch Geologen mit einer speziellen Genehmigung in den riesigen Steinbruch hinein, er ist aus Sicherheitsgründen komplett abgesperrt, es wird auch darin gesprengt. In den 1960er- bis 1980er-Jahren, als die Zugangsbeschränkungen weniger restriktiv waren, konnte man in den Hohlräumen des vulkanischen Gesteins gut kristallisierte Zeolithe wie würfelförmiger Chabasit, Gonnardit oder langprismatischer Natrolith finden. Der Fluorit kann in winzigen Würfeln auf dem langprismatischen Natrolith aufsitzen. Auch der Calcit sucht die Gesellschaft des Natroliths. Zu den vorkommenden Mineralen zählen zum Beispiel auch Apatit, Aragonit, Coelestin, Fluorapophyllit-(K) oder Pektolith, sowie gut kristallisierter Aegirin und weitere Minerale aus der Gruppe der Klinopyroxene. Die größte Rarität aus dem Steinbruch sind Fundstücke, bei denen der Opal in der Varietät Hyalith auf dem Natrolith aufsitzt oder diesen durchdringt. Beleuchtet man ein solches Aggregat mit einer UV-Lampe, wird der Opal schon bei Tageslicht aufgrund der starken grünen Fluoreszenz sichtbar.

Steinbruch Fohberg
Bötzingen

Aegirin
Steinbruch Fohberg

Apophyllit, Natrolith
Steinbruch Fohberg

Calcit
Steinbruch Fohberg

Calcit
Steinbruch Fohberg

Calcit, Natrolith
Steinbruch Fohberg

Coelestin
Steinbruch Fohberg

Fluorit, Natrolith
Steinbruch Fohberg

Hyalith, Natrolith
Steinbruch Fohberg

Hyalith, Natrolith
Tageslicht + UV-Licht
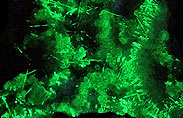
Hyalith, Natrolith
UV-Licht 365 nm

Natrolith, Chabasit
Steinbruch Fohberg

Natrolith, Gonnardit
Steinbruch Fohberg

Klinopyroxen
Steinbruch Fohberg

Pektolith
Steinbruch Fohberg

Wollastonit
Steinbruch Fohberg
Badloch bei Altvogtsburg, Oberbergen
Der Badberg bei Altvogtsburg beherbergt zahlreiche Natursehenswürdigkeiten. An den Felsen blüht ab Ende April der Färber-Waid, der im Kaiserstuhl eine Pionierpflanze darstellt. Der Trockenrasen auf dem rundlich geformten Badberg ist bekannt für seltene Orchideen-Arten wie das Affen-Knabenkraut. Eidechsen-Arten wie die Smaragdeidechse oder die Zauneidechse haben am Fuße des Badbergs ihren geschützten Lebensraum. Aus dem Steinbruch am Badloch stammt die Peroswkit-Varietät Dysanalyt, die früher an einer heute nicht mehr existenten „Dysanalytbank“ gefunden wurde. Die winzigen Würfelchen des seltenen Niob-Minerals konnte man mit Salzsäure leicht aus dem calcitreichen Karbonatit herauslösen. Die bräunlichen bis grünlichen, glimmerartigen Blättchen im Karbonatit bestehen aus Vermiculit. Die schwarze, titanhaltige Andradit-Varietät Melanit wurde nicht nur im Badloch, sondern auch in den Steinbrüchen am Kirchberg bei Niederrotweil gefunden.

Altvogtsburg
mit Badberg

Steinbruch
am Badloch

„Galerie der Vulkan-
gesteine“ am Parkplatz

Färber-Waid
Ende April

Affen-Knabenkraut
Ende April

Karbonatit
Badloch am Badberg

Dysanalyt herausgelöst
Badloch am Badberg
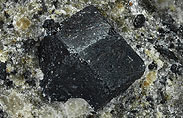
Melanit
Badloch am Badberg

Vermiculit
Badloch am Badberg
Ohrberg bei Schelingen
In den Steinbrüchen am Ohrberg (auch „Orberg“) bei Schelingen oberhalb von Oberbergen wurde früher Karbonatit zum Kalkbrennen abgebaut. In dem grobkörnigen, magmatisch gebildeten Kalk findet man die Perowskit-Varietät Dysanalyt, sowie Magnesioferrit in schwarzen, bis zu mehreren Millimeter großen Oktaedern, die Mischkristalle mit Magnetit bilden. Bei den winzigen, orangefarbenen bis lachsroten Oktaedern handelt es sich um „Koppit“. So bezeichnete man früher ein Mineral aus der Pyrochlor-Gruppe. Der Apatit tritt in feinen Nadeln auf, der Forsterit in gelblichen Körnern oder Kristallen. Der Phlogopit zählt zu den Glimmern, er bildet in der Idealform pseudohexagonale, sechseckige Prismen. Die mit Calcit ausgefüllten Adern können in den Hohlräumen Kristalle enthalten, diese sind sekundär sehr viel später entstanden.

Steinbrüche
Ohrberg

Fels aus der Nähe
Ohrberg

Belegstück mit Calcit
Ohrberg

Vergitterter Stollen
Ohrberg

Erzbunker
an der Straße

Calcit
Ohrberg

Dysanalyt
Ohrberg

Forsterit
Ohrberg

Koppit
Ohrberg

Koppit
Ohrberg

Magnesioferrit, Apatit
Ohrberg

Phlogopit
Ohrberg
Kirchberg bei Niederrotweil, Bischoffingen
Der Steinbruch Kirchberg mit seinem künstlich geschaffenen Durchbruch bei Niederrotweil ist ein markanter Orientierungspunkt am Eingang des Tales nach Oberbergen. Der Durchbruch ist heute ein Vogelschutzgebiet. Der Steinbruch ist aus verschiedenen Gesteinen aufgebaut, unter anderem aus Phonolith, Tephrit oder Tuff. Der Aegirin-Augit tritt oft zusammen mit gelbweißem Leucit auf, der viele Flächen ausbildet. In den Hohlräumen des vulkanischen Gesteins wurden zum Beispiel Andradit, Calcit, Cristobalit, Fluorit, Hämatit, Hyalith, Natrolith, Opal, Pseudobrookit und Sanidin, sowie verschiedene Pyroxene oder Zeolithe wie Phillipsit-Ca und Thomsonit-Ca gefunden. Leucit und Andradit in der schwarzen Varietät Melanit kommen auch in einem Aufschluss bei Bischoffingen vor.

Niederrotweil
mit Kirchberg (rechts)

Andradit
Stbr. Kirchberg

Calcit
Stbr. Kirchberg

Melanit
Stbr. Kirchberg

Melanit
Stbr. Kirchberg

Leucit
Bischoffingen

Melanit
Bischoffingen
Büchsenberg bei Achkarren
Der Büchsenberg bei Achkarren schließt direkt im Süden an. Dort kann man den Wechsel zwischen vulkanischem Gestein und dem darüber liegenden Löss gut beobachten. Die offene Südseite ist von den Reben dominiert, die vom fruchtbaren Löss profitieren. Der etwas im Wald versteckte Steinbruch liegt direkt am Parkplatz bei der großen Photovoltaik-Anlage. Er ist geprägt von Leucit-haltigem Tephrit oder vom Tuff, der von rötlichen Lapilli durchsetzt ist. Der Tephrit zeigt sich an den Bändern, die den Steinbruch durchziehen. Dort konnte man zum Beispiel Zeolithe wie Chabasit oder Merlinoit in Kristallbüscheln finden.

Weinberge
am Büchsenberg

Höhlen im Löss
Büchsenberg

Steinbruch
mit Photovoltaikanlage

Tephrit- und Tuffadern
Büchsenberg

Merlinoit
Büchsenberg
Humberg bei Jechtingen
Der Steinbruch am Humberg liegt direkt neben der mittelalterlichen Burg Sponeck. Diese befindet sich am Rand der Rheinauen auf der Gemarkung von Jechtingen, einem Ortsteil der Gemeinde Sasbach. Am und im Steinbruch lebt ebenfalls eine Population mit Smaragdeidechsen. Dort wurde der schönste Hyalith des Kaiserstuhls gefunden. Der klare, kugelförmige Opal sitzt meist auf dem Calcit oder dem Aragonit. Er fluoresziert im UV-Licht bei 365 nm grünlich. Chabasit und Phillipsit vom Humberg sind eher selten.

Burg Sponeck
am Humberg

Steinbruch von oben
Humberg

Steinbruch von unten
Humberg

Adern mit Calcit/Aragonit
Humberg

Vogesenblick
vom Humberg

Aragonit
Humberg

Chabasit
Humberg

Hyalith auf Aragonit
Humberg

Hyalith im UV-Licht
Humberg

Phillipsit
Humberg
Limberg bei Sasbach
Am Limberg liegen die bekanntesten Fundstellen für Mineralien am Kaiserstuhl. Der Berg ist heute ein Naturschutzgebiet, er befindet sich direkt am Altrhein nördlich von Sasbach. In den sieben Steinbrüchen wurde früher das Material abgebaut, das zur Befestigung des Rheinufers diente. Am berühmtesten sind der Steinbruch Nummer I links und der Steinbruch Nummer VII, der sich ganz rechts bis auf die Rückseite des Berges erstreckt. An den Steinbrüchen darf nicht mehr herumgeklopft werden, es besteht akute Steinschlaggefahr. Sie sind aber alle noch zugänglich, und sie werden für geologische Exkursionen regelmäßig auch von Schulklassen besucht. Im Limburgit durchsetzt der Augit das Gestein mit schwarzen, monoklinen Kristallen. Der Phillipsit bildet glitzernde Krusten oder Drusenfüllungen, sowie Zwillinge oder Mehrlinge. Der Offretit geht Mischkristalle mit dem Erionit ein, am Limberg besteht er aber überwiegend aus Offretit. Es kommen weitere Minerale wie nadelförmiger Aragonit, Calcit, Chabasit, wurmartiger Montmorillonit oder kugeliger Hyalit vor, sowie oktaedrischer Faujasit. Faujasit-Mg, Faujasit-Na und die Olivinvarietät Hyalosiderit treten am Limberg in der Typlokalität auf.

Steinbrüche I und II
Limberg

Steinbrüche VI und VII
Limberg

Steinbruch VII
Limberg (Rückseite)

Reste der Limburg
Limberg

Limburgit (mit Augit)
Limberg Stbr. VII

Aragonit
Limberg

Augit, Phillipsit
Limberg

Calcit
Limberg

Chabasit
Limberg

Faujasit TL
Limberg

Hyalith
Limberg

Montmorillonit
Limberg

Offretit
Limberg

Phillipsit Zwillinge
Limberg
Bemerkung: Die Stücke stammen fast alle aus alten Sammlungen, sie wurden zwischen 1960 und 1990 gefunden.
