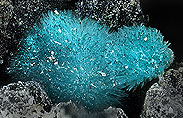Caledonit
engl. Caledonite
Nach den Caledonii, einem Volk das in der Römerzeit im heutigen Schottland lebte (Beudant 1832)
Formel
Stoffgruppe
Farbe
Strich
Glanz
Transparenz
Härte (Mohs)
Dichte
Spaltbarkeit
Bruch
Kristallsystem
Kristallklasse
Stoffgruppe
Farbe
Strich
Glanz
Transparenz
Härte (Mohs)
Dichte
Spaltbarkeit
Bruch
Kristallsystem
Kristallklasse
Cu2Pb5(SO4)3(CO3)(OH)6
Sulfate, Carbonate
blau, grünlich
hellblau
Glasglanz, Harzglanz
durchscheinend bis durchsichtig
2,5 – 3
5,6 g/cm³
vollkommen
uneben
orthorhombisch
orthorhombisch-dipyramidal
Sulfate, Carbonate
blau, grünlich
hellblau
Glasglanz, Harzglanz
durchscheinend bis durchsichtig
2,5 – 3
5,6 g/cm³
vollkommen
uneben
orthorhombisch
orthorhombisch-dipyramidal
Beschreibung
Eigenschaften
Caledonit ist ein meist hellblaues bis leicht grünliches Kupfer-Blei-Mineral, das relativ weich ist. Die durchscheinenden bis durchsichtigen Kristalle zeigen Glasglanz oder Harzglanz. Mit Salzsäure erfolgt kein Brausen wie beim Azurit oder beim Malachit, es tritt dabei auch keine Weißfärbung wie beim Linarit auf.
Kristallformen und Wachstum
Die nach dem orthorhombischen System kristallisierenden Kristalle weisen einen nadeligen bis prismatischen Habitus auf. Sie sind meistens nur sehr klein. Gerne bilden sie büschelige oder radialstrahlige Kristallgruppen, auch faserige oder krustige Aggregate kommen vor.
Geschichte
Die Benennung des Minerals erfolgte durch Beudant im Jahr 1832 nach den Caledonii, einem Volk das in der Römerzeit im heutigen Schottland lebte. Dies bezieht sich auf die erstmalige Entdeckung im Bergbaugebiet Leadhills im südwestlichen Schottland. Dort entdeckte es der britische Mineraloge Henry James Brooke im Jahr 1820, der den chemischen Grundaufbau der Komponenten des neuen Minerals schon beschreiben konnte.
Vorkommen
Caledonit bildet sich sekundär in der Oxidationszone von Bleierz-Lagerstätten, die mit Kupfererz angereichert sind. Es ist ein typisches Mineral der Schlackenhalden und der mittelalterlichen Feuersetzparagenese. Begleitminerale sind – neben weiteren – Anglesit, Azurit, Cerussit, Elyit, Leadhillit, Linarit oder Malachit.
Der Caledonit wurde früher zum Beispiel auf den alten Schlackenhalden am Silberbach bei Schulenberg im Oberharz oder auf den ehemaligen Abraumhalden der Insel Silberau in Bad Ems gefunden. Am Altemannfelsen in Badenweiler tritt der Caledonit zusammen mit Elyit auf. Diesen kann er durch eine Pseudomorphose umwandeln. Im Schwarzwald fand man das Sekundärmineral früher auch auf den heute zugewachsenen Willnauer Halden am Schauinsland oder bei Etzenbach im Münstertal.
Verwendung
Caledonit hat keine technische Bedeutung, bei den Micromountsammlern ist er für das Mikroskop oder für die Makro-Fotografie ein begehrtes Objekt.
© Thomas Seilnacht / Benutzerhandbuch / Lizenzbestimmungen / Impressum / Datenschutz / Literaturquellen