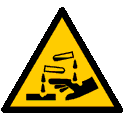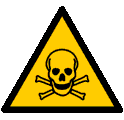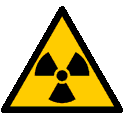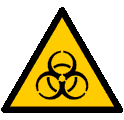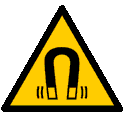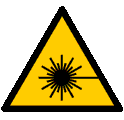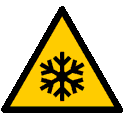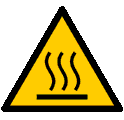|
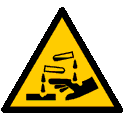
|
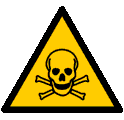
|

|
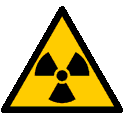
|
| Warnung vor feuergefährlichen Stoffen |
Warnung vor
ätzenden Stoffen |
Warnung vor
giftigen Stoffen |
Warnung vor
elektrischer Spannung |
Warnung vor
radioaktiven Stoffen und ionisierender Strahlung |
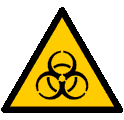 |
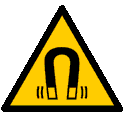 |
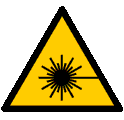 |
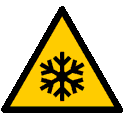 |
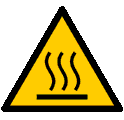 |
Warnung vor
Biogefahr |
Warnung vor
magnetischem Feld |
Warnung vor
Laserstrahl |
Warnung vor
Kälte |
Warnung vor
heißer Oberfläche
|
Welche der Warnzeichen (nach DIN EN ISO 7010) sind für den Chemie-, Physik- und Biologieunterricht von Bedeutung?
Grundlage
für einen sicheren naturwissenschaftlichen Unterricht sind Kenntnisse über die
wichtigsten rechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören zum Beispiel Fachkenntnisse über
die Stoffeigenschaften und über gefährliche Reaktionen der Chemikalien, sowie Kenntnisse über Inhalte
der wichtigsten Gesetze und Verordnungen zum Arbeitsschutz, zum Beispiel über das Chemikalienrecht.
Auch Gefahren, die von Maschinen und von elektrischem Strom ausgehen,
dürfen nicht unterschätzt werden. Im Physikunterricht sind vor
allem elektrischer Strom und radioaktive Stoffe gefährlich, im
Biologieunterricht sind es neben den Chemikalien zum Analysieren,
Färben und Konservieren auch Mikroorganismen (Symbol ganz rechts:
Biogefahr). Die sichere Bedienung von Laborgeräten, Gasbrennern und Gasflaschen muss gewährleistet sein. Die Lehrkraft ist mit den Sicherheitsvorkehrungen und
den Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut. Die Laboreinrichtung und eine Chemikaliensammlung werden verantwortungsbewusst gepflegt und betreut. Allgemein muss sich die Lehrkraft
an drei grundlegende Pflichten halten:
1.
Ermittlungspflicht
Als
professionelle Lehrkraft muss man sich eine Urteilskraft über das
Potenzial der Stoffe und möglicher Reaktionen verschaffen. Besonders problematisch sind Experimente an Schulen, die Gefahrstoffe mit der nachfolgenden GHS-Einstufung beinhalten (betroffen
sind Ausgangsstoffe, Zwischenprodukte und Endprodukte):
-
GHS 01 Explosionsgefahr, sowie Reaktionen bei denen Explosionen auftreten können
-
GHS 02 Entzündbare Stoffe, Kategorie 1 (zum Beispiel Diethylether)
-
GHS 03 Oxidierend wirkende Stoffe, Kategorie 1 (zum Beispiel Kaliumchlorat)
-
GHS 04 Ätzende Stoffe, Kategorie 1A
(zum Beispiel Natronlauge ab 1mol/l, konz. Schwefelsäure)
-
GHS 06 Akut toxische Stoffe, Kategorien 1 und 2 oral/dermal, 1 bis 3 inhalativ (zum Beispiel Schwefeldioxid)
-
GHS 08 Gesundheitsgefahr, CMR-Stoffe (zum
Beispiel Blei- oder Borsalze, Chromate) und sensibilisierend wirkende
Stoffe für Haut und Atemwege (zum Beispiel Anilin oder
Phthalsäureanhydrid)
-
Radioaktive Stoffe und Krankheitserreger
Übersicht GHS-Piktogramme
2.
Schutzpflicht (Beispiele)
-
Beim Experimentieren dürfen
gefährliche Stoffe nicht frei werden und wenn, dann nur im Rahmen
der gesetzlich erlaubten Grenzwerte (AGW
= Arbeitsplatzgrenzwert).
-
Mit bestimmten toxischen
Stoffen darf nur im Abzug gearbeitet werden.
-
Experimente mit CMR-Stoffen werden nicht als Schülerversuche durchgeführt. Es
wird empfohlen, auf diese Stoffe an Schulen weitgehend zu verzichten.
-
Explosivstoffe und Feuerwerk dürfen an allgemeinbildenden Schulen nicht hergestellt
werden. Auch von einer Lagerung wird dringend abgeraten (Rechtslage
Explosivstoffe).
-
Bei Experimenten mit heftigen,
exothermen Reaktionen sollte mit möglichst kleinen Mengen gearbeitet
werden, so dass der Effekt zwar deutlich sichtbar ist, aber für die Beteiligten
keine Gefährdung darstellt.
-
Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen
sind Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Dazu gehört je nach
Gefahrenlage das Tragen von Schutzbrille,
geeigneten Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, Gesichtsschutz oder
Atemschutz. Die ersten drei müssen im Klassensatz vorhanden sein.
Es
muss geprüft werden ob ein Abzug, ein
geschlossenes System oder eine Schutzscheibe eingesetzt werden
müssen. Maßnahmen zum
vorausschauenden Brandschutz, Überlegungen zur Lüftung und ein
ausreichender Sicherheitsabstand
sind ebenfalls notwendig.
-
Schülerinnen und
Schüler dürfen niemals mit Netzspannung oder gefährlichen
Spannungen oder Stromstärken – beispielsweise bei
Elektrolyse-Experimenten – arbeiten.
Beim Arbeiten mit schülergerechten Netzgeräten oder anderen
elektrischen Geräten darf niemals Wasser in das Gerät selbst
gelangen.
Übersicht Gebotszeichen und sicheres Arbeiten
3.
Informationspflicht
Zu Beginn des Schuljahres
erhalten die Schülerinnen und Schüler eine grundlegende Einweisung in das Arbeiten
mit Laborgeräten und gefährlichen Chemikalien. Vor jedem Schülerversuch
im laufenden Unterricht werden Informationen über mögliche Gefahren
gegeben:
-
Was könnte schlimmstenfalls
passieren?
-
Welche Sicherheitsvorkehrungen
sind notwendig?
-
Wie werden Stoffe entsorgt?
Eine Verletzung dieser Pflichten
kann zu rechtlichen Konsequenzen gegen die Lehrkraft führen. Das korrekte Besprechen der
Sicherheitsaspekte schützt die Lehrkraft aber auch besser bei
fahrlässigem Verhalten der Schüler. Vor allem vor dem ersten
Chemieunterricht ist eine Sicherheitseinweisung obligatorisch:
 |

|

|

|

|
Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
|
Rauchen verboten |
Essen und Trinken verboten |
Kein Trinkwasser |
Eingeschaltete Mobiltelefone verboten |
Auswahl an Verbotszeichen nach DIN EN ISO 7010
Mögliche Inhalte einer Sicherheitseinweisung
- Durchsprechen allgemeiner
Sicherheitsregeln und Demonstrieren der Regeln anhand von Gesten und Vorführungen anhand des Arbeitsblattes.
- Einteilung eines Arbeitsdienstes
zum Austeilen und Einsammeln von Geräten und Chemikalien.
- Kenntnis der wichtigsten Laborgeräte.
- Einführung in das Arbeiten
mit einem Gasbrenner.
- Kenntnis der GHS-Piktogramme und über mögliche Gefahren.
- Hinweise auf räumliche
Besonderheiten, beispielsweise Kenntnis der Rettungszeichen, des Standortes für ein Telefon, die Bedienung der Augenduschen und der Notaus-Schalter und das Verhalten im Brandfall.
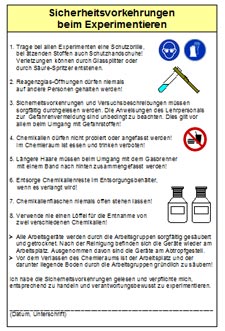
Infos und Materialien
Unterrichtseinheit zu den Gefahrstoffen
Arbeitsblätter zu den Laborgeräten und GHS
Ausführliche Sicherheitsempfehlungen des Autors
Chemikaliendatenbank
Bedienen eines Gasbrenners
Bedienen der Gasflaschen
Zusammenfassung des Chemikalienrechts
*)
Hinweise für Deutschland, Gefahrstoffverordnung und RiSU
Für das Arbeiten mit Gefahrstoffen müssen in Deutschland gemäß
RiSU der KMK in jedem Fall Gefahrenpotenziale und die zu treffenden
Maßnahmen durch eine fachkundige Person in einer Gefährdungsbeurteilung GBU geprüft und dokumentiert werden. Dies leitet sich auch
aus der
Gefahrstoffverordnung
ab. Es ist zu beachten, dass die Bundesländer teilweise eigene Richtlinien für das Arbeiten mit Gefahrstoffen an Schulen erstellt haben. Darauf wird hier nicht näher eingegangen.
Ob eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung mit
Betriebsanweisung und Unterschrift angefertigt werden
muss, hängt
vom Risiko
der Tätigkeit ab. Bei Tätigkeiten mit geringer
Gefährdung „kann auf eine detaillierte Dokumentation
(...) und eine
Betriebsanweisung“ verzichtet werden (RiSU der KMK Fassung 2023, S. 22 ff. und
Gefahrstoffverordnung §6, Absatz 11).
Eine geringe Gefährdung liegt nach der RiSU 2023 (S. 23) u.a. vor, wenn
- schultypisch geringe Stoffmengen eingesetzt werden,
- schultypische Arbeitsbedingungen verwendet werden,
- die dem Gefahrstoff zugeordneten Gefährlichkeitsmerkmale beachtet werden,
- eine nach Art, Dauer und Ausmaß schultypisch niedrige Exposition vorliegt.
Für solche Experimente reichen nach
der Gefahrstoffverordnung die „nach §8 zu ergreifenden
Maßnahmen zum Schutz...“ aus (Quelle: Gefahrstoffverordnung
§6, Absatz 11).
Bei Experimenten mit mittlerer und
hoher Gefährdung muss eine Betriebsanweisung mit einer Auflistung
der Gefahrstoffe, der möglichen Gefahren und
der Schutzmaßnahmen, sowie eine Ersatzstoffprüfung schriftlich angefertigt und (mit Unterschrift) dokumentiert werden. Die Unterweisung erfolgt durch die Schulleitung an die Beschäftigten. Dies kommt immer
dann zur Geltung, wenn keine geringe Gefährdung vorliegt.
Gesetzliche Grundlagen
> Gefahrstoffinformationssystem DEGINTU der DGUV: abrufbar auf: https://degintu.dguv.de
> Gefahrstoffverordnung des Gesetzgebers
> Empfehlung der Kultusministerkonferenz: Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU, 1994, 2013, 2016, 2019 und 2023)
**)
Hinweise für die Schweiz, ChemRRV und Nationaler Leitfaden
Während
die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV gesetzlich
verbindlich ist, hat der 2019 herausgegebene Nationale Leitfaden der chemsuisse nur empfehlenden Charakter. Der genaue Titel lautet: Sicherer
Umgang mit Chemikalien, Mikroorganismen und radioaktiven Stoffen an
Schulen - Leitfaden für Verantwortliche an den Schweizer Schulen
der Sekundarstufen I und II. Hier kurz zusammengefasst die wesentlichen Kernpunkte in Bezug auf die Chemikalien:
-
Schulen gelten zwar als Betrieb, Schülerinnen und Schüler sind
aber keine Arbeitnehmende. Lehrkräfte haben ihnen gegenüber
eine Obhuts- und Aufsichtspflicht
und sind für ihre Unversehrtheit verantwortlich. Es gilt daher das
Jugendschutzgesetz.
-
Für neue Experimente, die von Lehrkräften oder
Schülerinnen und Schüler entwickelt werden, wird das Erstellen
von Sicherheitsbetrachtungen SB empfohlen. Liegen Sicherheitshinweise bei Experimentierbeschreibungen aus der Fachliteratur vor, ist dies nicht notwendig.
-
Der Einsatz der Chemikalien ist an die Gegebenheiten angepasst. Dabei
spielen zum Beispiel das Alter und die Ausbildung der Beteiligten oder
die Ausstattung der Schule eine Rolle. Diese Prüfung kann ergeben,
dass der Einsatz nicht zu verantworten ist. Für besonders
problematische Stoffe wird eine Ersatzstoffprüfung empfohlen.
-
Im Nationalen Leitfaden sind einige wenige, an Schulen aufgrund der
ChemRRV verbotene Stoffe aufgeführt. Im Anhang E des Leitfadens
werden für Schulen problematische Stoffe in einer Tabelle genannt.
Die dort genannten Empfehlungen werden vom Autor in der Chemikalienliste berücksichtigt.
Download des Leitfadens als pdf in drei Sprachen bei der chemsuisse
|