Anknüpfung, Vorgehen und Ziel
„Dass man Mathematik und Physik um der geistigen Schulung willen lerne und zum Verständnis wichtiger Erscheinungen des praktischen Lebens, ist so sehr anerkannt, dass darüber die erzieherischen Wirkungen dieser Unterrichtsfächer leicht vergessen werden.“ (Wagenschein 1965, S. 26)
Seit Martin Wagenschein dies vor mehr als dreißig Jahren sagte, hat sich wenig geändert in den Auffassungen der Naturwissenschaftslehrer und -lehrerinnen. Vereinzelt werden solche Forderungen vorgebracht, etwa von Müller (1997), aber sie sind noch sehr spärlich. Immerhin spielen die erzieherischen Inhalte in den deutschsprachigen Lehrplänen zunehmend eine Rolle, auch wenn in der Unterrichtspraxis immer noch stark fachorientiert unterrichtet wird. Auf dem Hintergrund meiner Unterrichtserfahrung im Chemie- und Biologieunterricht und mit Bezug auf die von Markus Müller angestoßene und jüngst in dieser Zeitschrift geführte Diskussion (vgl. Müller 1996 und 1997, Dahlmann 1998) über den Aspekt der Erziehung im Chemieunterricht möchte ich im Folgenden meine Position eines neuen und umfassenden Natur- und Erziehungsverständnisses für den naturwissenschaftlichen Unterricht darstellen und begründen. Außerdem werde ich - im Gegensatz zu Dahlmanns teilweise berechtigter aber teilweise auch an Spitzfindigkeiten festgemachter Kritik - die wesentlichen und, wie ich meine, neuen Gedankengänge von Müller noch einmal herausarbeiten.
Es geht um eine umfassendere Sicht der Erziehungsaufgaben im Fachunterricht und zugleich um konkrete und detaillierte Anknüpfungspunkte an die bestehende Unterrichtspraxis und fachdidaktische Diskussionen. Ausgangspunkt ist die Kritik an der vorherrschenden Fachdidaktik, welche immer noch stark vom systematischen Fachwissen her geprägt ist. Zur Erläuterung einer neuen Position gehe ich von vier Thesen als Grundanforderung für naturwissenschaftlichen Unterrricht aus, die ich im folgenden ausführlich begründe:
These 1 (nach Messner,
Rumpf und Buck):
Eine Pluralität von Wissensformen
ist im allgemeinbildenden Unterricht anzustreben, damit knüpfe ich
an die Vorschläge von Messner, Rumpf und Buck (1997) an.
These 2 (nach Markus
Müller):
Unterricht darf sich nicht nur auf einer
an der Fachwissenschaft orientierten Ebene abspielen, sondern sollte vor
allem auch pädagogische Aufgaben wie Methodenkompetenz, Sozialkompetenz
und Ichkompetenz wahrnehmen. Ich orientiere mich an Markus Müllers
Vorschläge (1996, 1997).
These 3 (eigene
Position einer praktischen Ethik):
Für das erzieherische Wirken im Unterricht
reicht es nicht aus, wenn die Kompetenzen nur in den Köpfen der Schüler
und Schülerinnen theoretisch erprobt werden, vielmehr müssen
Wissen und Erleben in einer praktischen Ethik miteinander verknüpft
werden.
These 4 (nach
Wagenschein und Buck):
Bis in die Experimentalanordnung hinunter
muss Verstehen Lehren (Wagenschein) und zusammenschauend-soziales Lernen
(Buck) stattfinden können.
These 5 (Konsequenzen
aus Bucks Didaktik des Atombegriffs):
Erkenntniswege müssen kritisch hinterfragt
und gründlich durchleuchtet werden, dies gilt vor allem für die
Hinführung zum Modelldenken im Chemie- und Physikunterricht; am Beispiel
des Atomismus werde ich dies darlegen.
These 6 (Darstellung
einer eigenen, naturphilosophisch orientierten Position):
Darüber hinaus erachte ich es für
unabdingbar, dass nicht nur logisches (häufig sogar zirkulär
logisches), sondern auch vernetztes und komplementäres Denken bewusst
gefördert wird. Ich versuche, den Begriff der Komplementarität
transparent zu machen und Konsequenzen für die Schule daraus abzuleiten.
1.
Pluralität der Wissensformen im Sinne einer Allgemeinbildung (These
1)
Die Schule, eingeschlossen darin der naturwissenschaftliche Unterricht, versteht sich als Organisation, die vorrangig Allgemeinbildung fördert und den heranwachsenden Menschen befähigt, in der Gesellschaft zurechtzukommen. In dem bemerkenswerten Beitrag von Messner, Rumpf und Buck „Natur und Bildung“ (1997) orientieren sich die Verfasser expressis verbis an diesem Bildungsverständnis und fordern eine Pluralität verschiedener Wissensformen von der Natur, die weit über das herkömmlicherweise sehr einseitig thematisierte systematische Fachwissen hinausgehen. Sie unterscheiden fünf solche Wissensformen, die freilich nicht als Addition aufgefasst werden sollten, sondern als sich wechselseitig befruchtende Synthese:
a) Das lebenspraktische, pragmatische Umgangswissen
Dieses Wissen „empfiehlt Handlungsweisen für eine sinnvolle, die Lebensgrundlagen erhaltende menschliche Praxis“. Im naturwissenschaftlichen Unterricht zeigt es sich in der Kenntnis der Eigenschaften verschiedener Stoffe an alltäglichen Handlungszusammenhängen. Die Lebensrelevanz für die Schüler und Schülerinnen spielt eine entscheidende Rolle. Kenntnisse über Rohstoffe, Haushaltschemikalien, Medikamente oder Nahrungsmittel vermitteln einen vernünftigen und die eigene Zukunft betreffenden Umgang mit Stoffen. Damit orientieren sich die Verfasser an dem Bildungsbegriff von Wolfgang Klafki: Bildung ist nach Klafki ein „gesellschaftlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der gemeinsamen Gegenwart und der voraussehbaren Zukunft (...) und Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller...“ (1985, S. 20). Soll dieses pragmatische Wissen erziehend wirksam werden, dann darf es sich freilich nicht nur in einer technisch-materiellen Ausbeutung der Natur zeigen, sondern soll ein reflektiertes Bewusstsein über Langzeitauswirkungen eigener Handlungen auf die Natur und der nachkommenden Generationen schaffen.
b) Das systematische, präzise Wissen
Das systematische Wissen versucht, abstrahierend Phänomeneklassen zu Naturgesetzen zu verallgemeinern. Mit Hilfe von differenzierten Messmethoden und von experimentellen und gedanklichen Strukturierungen werden gesetzmäßige Zusammenhänge hergestellt. Dabei spielt die Verwendung einer Fachsprache, welche sich von der unmittelbaren Begegnung mit der Natur löst, eine entscheidende Rolle. Diese Wissensform spielte bisher in der Schule die bedeutendste Rolle. Sie ist auch in der Zukunft weiterhin notwendig, aber sie darf nicht, wie bisher, überbewertet werden.
c) Das verstehende Wissen
Für diese Wissensform ist entscheidend, wie das Wissen beim Lernenden zustande gekommen ist. Erst durch genetische, individuell bedeutsame Lernprozesse, d.h. im Erkennen aller Entstehungs- und Wirkungszusammenhänge ist eine tiefergehende Erkenntnis in vielfältige und komplexe Beziehungsstrukturen möglich. Das verstehende Wissen will nicht nur Informationen vermitteln, sondern es hinterfragt die Naturdinge und interpretiert sie individuell. Ethische Fragen sind darin impliziert: „Das verstehende Naturwissen wird ein genetisches im doppelten Sinn sein müssen: es wird den Werdegang des Wissens im lernenden Individuum so ernst nehmen müssen, wie Wagenschein uns dies vorgeführt hat, und man wird dabei stets die kulturalistische Seite der Wissensgenese auch im Auge haben müssen.“ (Messner, Rumpf & Buck, 1997)
d) Das mimetisch-symbolische Wissen
Naturdinge werden bei dieser Wissensform nicht mehr als tote Objekte, sondern als „eine Art antlitzhaftes Gegenüber“ erlebt. Durch eine kulturgeschichtlich begründete Naturerfahrung entstehen im Menschen symbolische und metaphorische Bilder, die durch den Menschen in künstlerischer Form wiedergegeben werden können. Diese „nachahmende Erfahrung“ wird in Anlehnung an Adorno „mimetisch“ genannt. Kulturgeschichtlich war sie für den Menschen von großer Bedeutung. Etwa: Durch die Naturerfahrung mit dem Wasser wurde dieses für den Menschen zum Symbol der Reinigung oder der Bedrohung.
e) Das exakte, physiognomische Wissen
Dieser Wissensform geht es nicht so sehr
um Naturerlebnisse, sondern um die portraithafte Beschreibung von Naturdingen.
Es handelt sich um ein umfassendes Wissen von Bezügen. Das Staunen
über die vielfältigen Phänomene der Natur in ihren Wechselbezügen
führt zu einer Verwurzelung mit den Dingen. Auch dies lässt sich
am Beispiel Wasser verdeutlichen: Wasser ist „mehr als nur H2O“.
Kranich (1996) malt ein solches Portrait vom Wasser; es spielt in
den ökologischen Systemen der Natur eine wichtige Rolle; Böhme
(1996) malt ein anderes, ein kulturgeschichtliches Porträt. Beide
Portraits sind sozusagen mit Naturwissen gemalt. „So wie zehn Portraitisten
zehn verschiedene aber gleichwohl treffende Portraits ein und derselben
Person malen oder zeichnen können, so treffen alle genannten Wasserportraits
Wesenhaftes des Wassers. “ (Messner, Rumpf & Buck, 1997, S. 23)
Die Synthese dieser Wissensformen führt
zwar zu einem umfassenderen Verständnis von Natur wie es bisher in
den Schulen gelehrt und gelernt wurde, doch wäre ein solches Wissen
wirkungslos, wenn es nur in den Köpfen der Schüler und Schülerinnen
stattfindet. Aus diesem Grunde bedürfen die Forderungen von Messner,
Rumpf und Buck einer Ergänzung. „Nachahmende Erfahrung“ führt
nicht zu aktiven Handlungen, wenn das Wissen nicht leibhaftig erfahren
und im Dialog mit der Umwelt ausprobiert wird. Daraus ergibt sich die zweite
These:
2.
Begründung eines pädagogischen und erzieherisch wirksamen Unterrichts
(These 2)
Müller schließt in seinem Beitrag „Erziehung in einer vom Fachwissen dominierten Schulpraxis?“ (1997) teilweise diese Lücke und wirft der bisherigen Chemiedidaktik eine Missachtung von Veränderungen in der Gesellschaft und von Problemen und Bedürfnissen der heutigen Jugendlichen vor. Aufgabe des Fachunterrichts sei nach Müller nicht nur das In-den-Vordergrund-Stellen von fachlichen Zielen, sondern vor allem auch die Berücksichtigung von pädagogischen Aufgaben wie Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Ichkompetenz. Das Entscheiden und Handeln des Menschen versteht Müller - in Anlehnung an Max Scheler (1995) - als Synthese von Rationalität, Emotionalität und Moralität. (vgl. ausführlicher: Müller 1995)
Die rationale Durchdringung von Emotionen, bzw. die Selbstreflektion führe zu einer Transparenz des eigenen Ichs und damit zu Mündigkeit, dialogischer Kompetenz und daraus resultierendem Verantwortungsbewusstsein. Müller betont die Bedeutung dialogischer Kompetenz in Anlehnung an die Diskursethik von Habermas (1983, 1991). Gesellschaftliche Werte und Normen könnten vorrangig durch den praktischen Diskurs in konkreten Gesprächssituationen von allen beteiligten Schülern und Schülerinnen entwickelt werden. Erziehung lasse sich „als eine argumentative Auseinandersetzung, ein kommunikatives Handeln ansehen, das als Suche nach zustimmungsfähigen Normen von den Adressaten eigenständig erfahren werden muss“. Dahlmann (1998) weist in seiner kritischen Stellungnahme darauf hin, dass nicht alle Normen und Werte dialogisch ausgehandelt werden können, da die Lehrperson von den Schülern immer auch als Vorbild angesehen wird. Müller verneint aber nicht grundsätzlich die Autorität der Lehrkraft, er stellt jedoch die Wertevermittlung an den Schulen aufgrund der herrschenden Unterrichtspraxis in Frage und fordert eine Demokratisierung.
„Wir müssen uns als Lehrende bemühen, Werte, Ziele und Zwecke nicht aufzuzwingen; engagierte Einseitigkeit verführt dazu. Die Gefahr, dass diese Werte in ihr Gegenteil umschlagen, wäre zu groß. Nochmals: Lehrende, die engagierte Einseitigkeit nutzen, müssen sich davor hüten, Leitbilder zu profilieren. Das gilt vor allem für ethische Wertsetzungen - was moralische Werte betrifft, sind wir auf die moralische Atmosphäre in einer Lebensgemeinschaft (...) angewiesen, hier spielen vor allem organisatorische Maßnahmen im Sinne symmetrischer Kommunikation und also auch Gerechtigkeit eine Rolle.“ (Müller 1996, S. 93)
Lehrer und Lehrerinnen sind gefordert, ein reflektiertes Selbstbewusstsein anzustreben, da sie in den Dialog fest eingebunden sind. Bestimmte Lehrerpersönlichkeiten (nach Oser/Althoff, 1997) behindern jedoch diesen Prozess: Manche Lehrer vermeiden Konfliktsituationen (Typ des Vermeidens) oder schieben die Verantwortung ab (Typ des Delegierens), andere entscheiden über die Situation alleine (Typ des Regulierens). Stattdessen macht Müller allen Lehrkräften Mut, Entscheidungen und Handlungen verantwortungsbewusst zu tragen und gemeinsam mit den Schülern Lösungen zu suchen. Dies bedeute keine Schwächung der Lehrerpersönlichkeit, wovor manche Kollegen und Kolleginnen möglicherweise Angst haben, sondern letztendlich eine Stärkung der Überzeugungskraft und der Persönlichkeit aller Beteiligten. Das Bild der Lehrerperson, welche aus Erfahrungen und Konfliktsituationen immer wieder lernt, entspricht auch meinen Vorstellungen über das hermeneutische Verstehen, wie ich es im Zusammenhang mit der Freiarbeit dargestellt habe (vgl. Seilnacht 1996 und Danner 1998).
Müller fordert eine stärkere Verknüpfung der bisherigen naturwissenschaftlichen Fachdidaktik mit der Pädagogik und der Philosophie. Bildung darf nach Müller niemals nur das bloße Aufnehmen von Wissen sein, sondern sie sollte ein rational durchdrungenes und differenziertes Persönlichkeitsbild schaffen. Ziel ist Moralbewusstsein - im Sinne von Kant und Habermas. Die Forderung nach einer ethischen Pädagogik, bzw. einer ethisch-pädagogisch motivierten Fachwissenschaft ist bei Müller ein wesentlicher Aspekt.
Ausgehend von einem Bildungsbegriff, der
den Menschen in seiner Ganzheit als rational denkendes, emotional fühlendes
und sozial handelndes Wesen begreift, - so möchte ich hinzufügen
- sind für den naturwissenschaftlichen Unterricht - und für
alle anderen Fächer ebenfalls - als Grundqualifikationen einzufordern:
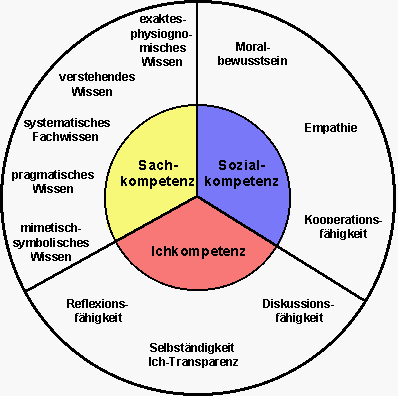
Müller stellt zwar ein pädagogisches Konzept vor, doch leider verharrt er auf der begrifflichen Ebene. Seine Ausführungen über die Unterrichtsbeispiele zum Thema „Atome“ verdeutlichen nur ansatzweise, wie ein von ihm geforderter Unterricht wirklich aussehen könnte. Aus diesem Grunde möchte ich die Praxis des Unterrichtsalltags konkreter erörtern und andere Unterrichtsbeispiele nennen.
Wenn wir von Naturwissenschaft sprechen, meinen wir – dem gemeinen Verständnis nach - das klassisch-naturwissenschaftlich gewonnene „Wissen“ über die Natur (das „systematische Wissen“ s.o.). Wir glauben, wir könnten Natur verstehen, indem wir sie hinterfragen und Antworten erhalten. Der Mensch hat dafür eine eigene Sprache entwickelt. Dies liegt im menschlichen Wesen begründet. Er versucht, über sich selbst hinauszusehen. Ich möchte aufzeigen, dass dieses „Über-sich-selbst-Hinaussehen“ die Gefahr in sich birgt, das eigene Wesen zu übersehen und seine eigentliche Bestimmung des durch die Welt mit offenem Blick Wandelnden und Suchenden aus den Augen zu verlieren.
Im naturwissenschaftlichen Unterricht lernen die Schüler und Schülerinnen in der Regel über mediale Erfahrungen einen Vorrat an „Wissen“, mit dem sie die Naturgesetze „begreifen“ sollen. Je höher der geistige Einsatz, um so mehr glauben sie zu wissen und zu verstehen. Naturwissenschaftlicher Unterricht findet weiterhin meist in abgeschlossenenen Unterrichtsräumen statt. Verwendet werden Texte, Bilder, Modelle, Filme und experimentelle Aufbauten. Das Ergebnis ist ein präpariertes Wissen von der Natur in unseren Köpfen, welches aber von der tatsächlich erfahrbaren Natur erheblich abweicht, da sich unser Wissen nicht auf das unmittelbare Erleben stützen kann, sondern auf künstlich konstruierte Experimentalanordnungen. Hilfsgeräte wie Mikroskop oder Fernrohr eröffnen uns zwar neue Perspektiven - das ist nicht abzustreiten - sie entfernen uns aber auch gleichzeitig von der unmittelbar erfahrbaren Natur. Wir sehen im Fernrohr die Wirklichkeit durch eine Linse, welche nur noch einen ganz bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit zeigt. Die Linsen zerstückeln die Wirklichkeit in Ausschnitte, hinterher setzen wir die Ausschnitte wieder zu einem „neuen“ Weltbild zusammen. Dieses Weltbild ist ein von uns konstruiertes Weltbild des Wissens, da wir die Experimentalanordnung und die Auswahl der Ausschnitte von vornherein festgelegt haben.
Im Deutschunterricht verhält es sich mit der Sprache ähnlich. Die Sprache wird in Rechtschreibregeln, Zeichensetzungsregeln, Ausspracheregeln, Grammatik- und Stilregeln zergliedert. Wenn wir die Regeln unseren Köpfen einverleibt haben, glauben wir korrekt reden und schreiben zu können. Die Schüler schreiben Diktate und Texte, zu denen sie nicht den geringsten emotionalen Bezug besitzen, sie schreiben sie nur der Regeln wegen und nicht um ihrer Erlebnisfähigkeit willen. Schlimmstenfalls wird die so erlernte Sprache dann in benoteten Diktaten oder Aufsätzen beurteilt. Doch was bewertet wird, ist nicht die eigentliche, verinnerlichte Sprache, sondern eine Vorgehenstechnik, um Sprache zu benutzen, damit Schüler für ihr späteres Leben oder Berufsleben gut vorbereitet sind. Im naturwissenschaftlichen Unterricht dient das Wissen von der Natur zur Nutzbarmachung und letztendlich zur Ausbeutung der Natur. Deutschunterricht verfolgt im Prinzip dasselbe Ziel, wenn er Sprache nicht verinnerlicht.
Als drittes Negativbeispiel könnte
man den gängigen Gemeinschaftskunde- und Religionsunterricht anführen.
In eigens dafür eingerichteten Unterrichtsstunden und separiert von
anderen Lebens- und Unterrichtszusammenhängen sprechen wir über
Gewissensfragen und Ethik, über den gemeinsamen Umgang zwischen uns
und zwischen den Gesellschaftsmitgliedern. Im Klassenzimmer herrschen andere
Normen als draußen: Gehen wir jedoch aus dem theoretischen Unterricht
heraus, finden wir eine Welt, in der das rücksichtslose Durchsetzen
der eigenen Interessen Vorrang hat. Diese Welt beginnt bereits im Umgang
zwischen allen Beteiligten des Schulwesens untereinander. Ich möchte
es so formulieren: Wir erlernen nicht, wie wir in konkreten Situationen
miteinander umgehen, sondern wir erlernen das (theoretische) Wissen, wie
wir miteinander umzugehen haben. Zwischen „Sein“ und „Haben“ besteht
ein erheblicher Unterschied. Im Sein sind wir gezwungen, in konkreten Gesprächs-
und Handlungssituationen zu agieren. Wenn wir aber beispielsweise die Zehn
Gebote lesen und auswendig lernen („kennen“), heißt das noch lange
nicht, dass wir uns auch daran halten werden. Die Schule fördert nicht
das Er-Leben im Sein, sondern sie vermittelt einseitig das erhabene
Wissen über das Sein. Wer einen brillanten Aufsatz über die Zehn
Gebote schreibt, wird mit einer guten Note belohnt. Selbstverständlich
wird jeder Schüler und jede Schülerin dies anstreben und behaupten,
dass er die Zehn Gebote besonders gut verstanden hat. Insofern legt die
Schule bereits früh den Grundstein für eine verlogene Moralgesellschaft,
die für alle Selbstbelügungen eine Entschuldigung parat hat.
Man hat gelernt, nach außen Moral zu beweisen, aber man muss sich
ja nicht daran halten, wenn es niemand sieht. Zu Fordern ist aber ein Handeln,
welches vom Herzen bestimmt und vom Wissen rational reflektiert wurde.
Dieses Handeln kann nur durch konkrete Situationen und durch Anteilnahme
an der anderen Person erlernt werden.
Anhand der drei geschilderten Beispiele wurde gezeigt, dass uns eine Bildung, auch wenn sie möglichst große Vollständigkeit an Wissen anstrebt, nicht weiterführt. Stattdessen ist eine dringende Kurskorrektur notwendig, wenn wir uns nicht zu einer Gesellschaft der „Wissensidioten“ entwickeln wollen. Ich möchte aufzeigen, welche Wege in den drei geschilderten Bereichen an den Schulen gegangen werden könnten, um uns hiervor zu bewahren. Ich fordere dabei, dass die Schule eine Verknüpfung von Erlebnisfähigkeit und Wissenskompetenz herstellt. Dabei sollte das Erleben von Natur, von Sprache und von Gemeinschaftserfahrung denselben Stellenwert besitzen wie die reine Wissensvermittlung. Da diese Forderungen nicht ausschließlich für den naturwissenschaftlichen Unterricht von Bedeutung sind, nenne ich Beispiele für alle Fachbereiche.
Wenn wir die Natur, der wir selbst angehören, wirklich im Bewusstsein verinnerlichen wollen, reicht es nicht aus, die Naturgesetze mit unserer Sprache zu beschreiben, um die Natur zu verstehen. Natur sollte unmittelbar und mit der ganzen Vielfalt der Erlebnisfähigkeit unserer Sinne erfahren und kreativ gestaltet werden. Der Lernort Schule hätte sich dafür zu öffnen. Ein paar Unterrichtsstunden im „Lernort“ Natur sind dafür niemals ausreichend. Naturerfahrung kann sich nur dann niederschlagen, wenn Schüler und Schülerinnen nachhaltige, mehrtägige oder mehrwöchige Naturerfahrungen machen und/oder die Natur künstlerisch nachbilden. Problematisch ist, dass der heutige Mensch in den Industriestaaten die Fähigkeit verlernt hat, sich in der Natur ohne technische Hilfsmittel zurechtzufinden. Er ist bereits ein Produkt einer Gesellschaft, die zu einer technischen „Wissensfabrik“ verkam.
Die Trennung „Freizeit“ hier und „Schule“ dort ist genauso wenig mehr tragbar wie die Trennung der musischen Fächer von den Naturwissenschaften, da gerade diese Trennung den Graben zwischen Erleben (in der Freizeit) und Anreichern von Wissen (in der Wissensanstalt Schule) vergrößert. Eine Schule, die den Anspruch erhebt, Allgemeinbildung zu vermitteln, sollte aber den Menschen in seiner Gesamtheit bilden, zum Beispiel in Projekten zum Erleben und kreativen Gestalten von Natur wie:
- Die Natur mit unseren Sinnen aus verschiedenen Perspektiven (Tages- und Jahreszeiten) erfahren
- Nächtliche Erkundungsgänge zur Beobachtung des Sternenhimmels
- Orientierungsspiele in der Natur
- „Aufmerksamkeiten“ üben etwa im Umgang mit Wasser, wie Rumpf (1995) dies beschreibt,
- Betreuung von Biotopen oder Naturschutzgebieten in der näheren Umgebung
- Biologische Exkursionen im Freien
- Physikalische Naturgesetze und chemische Vorgänge im Freien beobachten
- Naturfarbstoffe und ihre kreative Verarbeitung
a) Sprache erfahren und Sprache anwenden
Zur bewussten Verinnerlichung der Sprache ist vor allem das Sprechen und der eigene Ausdruck von Stimmungen und Gefühlen notwendig. Sprache ist Ausdruck der Persönlichkeit. Selbst der beste Redner ist sprachlos, wenn er nicht sich selbst ist. Schüler und Schülerinnen sollten sytematisch und oft Gelegenheit erhalten, um sich selbst darstellen und ausdrücken zu können.
Sprache findet vorrangig im gesprochenen Wort statt. Aus diesem Grunde sollte die Schule, als eine der größten Anstalten der Kommunikation in unserer Gesellschaft, für jeden und jeder die Möglichkeit schaffen, ausführlich und nachhaltig Dialoge zu führen - und nicht nur in den kleinen und großen Pausen. Dabei sollten Gesichtspunkte wie die nachstehenden unbedingt berücksichtigt werden:
Nach jedem Wochenende, nach jedem Ereignis, nach jeder länger anhaltenden Trennung einer Gruppe findet eine Gesprächsrunde statt, in der sich die Teilnehmer mitteilen, wie sie sich gerade fühlen, was sie am Wochenende gemacht haben oder was sie auf dem Herzen haben. Probleme werden gemeinsam besprochen. Man teilt sich eigene Einstellungen oder Erwartungen mit.
Das Schreiben ist eine besondere Form der Kommunikation, ein inneres Sprechen sozusagen. Der Vortrag von eigenen Texten an unterschiedlichen Orten, z. B. von Naturlyrik, sollte zur regelmäßigen Gewohnheit werden. Im Schreiben werden die eigenen Gefühle und Meinungen reflektiert, es verknüpft das Erleben mit dem Wissen. Die Reflexion findet durch den Verfasser oder die Verfasserin selbst und durch die Zuhörer statt. Musik, Körperausdruck und kreatives Gestalten im Kunstunterricht erfüllen ähnliche Funktionen. Peter Stettler (1997) hat zahlreiche Beispiele solcher Textproduktionen gegeben.
Im reinen Frontalunterricht wird die Sprache in der Regel eingesetzt, um Wissen zu transportieren. Die Sprache dieser Unterrichtsform ist eine wenig lebendige Sprache, da innere Mitteilungen des Sprechers nur noch eine sehr unbedeutende Rolle spielen. Wenn es dem Lehrer oder der Lehrerin aber gelingt, eine Beziehung zu seinen Zuhörern herzustellen, beginnt die Sprache zu leben. Dies ist in den „offenen“ Unterrichtsformen prinzipiell besser möglich. Politische Reden, die Sprache in der Berufswelt oder die wissenschaftliche Fachsprache sind in der Regel leblos. Daran kann man auch erkennen, dass unsere Gesellschaft schon weitgehend sprachlos geworden ist und ihre Ausdrucksfähigkeit verloren hat.
Mit dazu beigetragen hat, dass weitgehend nur das Aufnehmen von Eindrücken, Informationen usw. als wichtig für schulische Lernprozesse angesehen wird, nicht aber die Wiedergabe des Verstandenen, die einen vom Individuum gesuchten Ausdruck voraussetzt. Im Kapitel „Die zwingende Rhythmik des Atmens“ hat Buck (1997) darauf hingewiesen, wie unabdingbar der Ausdruck und nicht nur der Eindruck für ein lebendiges Lernen ist.
b) Gemeinschaftserfahrung und Ethik
Das Wort Gemeinschafts“kunde“ besagt im Prinzip schon, um was es gehen soll. Es ist ein Wissen um die Gemeinschaft gemeint, aber keine echte Gemeinschafts-erfahrung; wir sind erneut bei dem Problemen unserer Wissens(un)kultur. Die erlebte Erfahrung sollte aber immer wieder, jederzeit und überall in der Schule stattfinden. Von diesem Gesichtspunkt aus gewinnt das bisherige Fach „Gemeinschaftskunde“ eine völlig neue Bedeutung. Die Schüler und Schülerinnen sollen erfahren,
- wie man miteinander umgeht und wie man Probleme gemeinsam löst,
- wie man miteinander diskutiert und auf welche Verständigungsregeln man sich einigt,
- wie man auf andere Rücksicht nehmen muss und wie man andere verletzt,
- wie man eigene Bedürfnisse einbringt und auslebt,
- welche Konsequenzen das Ausleben eigener Bedürfnisse für die Umwelt haben kann.
Für eine ausgeglichene Vermittlung der zuvor geforderten pädagogischen Bildungsinhalte im naturwissenschaftlichen Unterricht sollte jeder Schulabgänger mindestens einmal eine ausführliche, naturwissenschaftliche Dokumentation erstellt haben, die als Ergebnis eines (bzw. mehrerer) Projekte oder Freiarbeitseinheiten vorliegen. Inhalte einer solchen Dokumentation könnten sein:
- Selbständiges Sammeln und Auswerten von Sachinformationen
- Selbständige Planung von Vorhaben in Abstimmung mit Gruppenpartnern
- Reflexion über eigene Lernerfolge und eigenes Verhalten
- Ein Projekt zum Bereich Umwelterziehung
- Ein Projekt in Verbindung mit dem Fach Kunst, z.B. das Farbenprojekt, wie ich es in der Zeitschrift Unterricht Biologie 6/98 angedeutet habe (Seilnacht 1998/2, S. 50-51 und Beihefter)
- Lernzirkel und Freiarbeitseinheiten zu verschiedenen Themenbereichen, z.B.:
- Der Stoff- und Materialparcours
- Unsere Umwelt mit den Sinnen wahrnehmen
- Freiarbeitseinheit zum Thema Säuren, Laugen, Salze
- Durchführung eines Rollenspiels, z.B. „Düngemittel, zum Wohle der Menschheit?“ (Seilnacht 1995)
Müller (1997) dehnt das im vorigen Abschnitt geschilderte „dialogische“ Prinzip auch auf das Fachvokabular aus. Tragende Fachbegriffe dürften nicht nur einfach gesetzt, sondern sie müssten in bestimmten Fällen ausgehandelt werden (vgl. hierzu auch Münzinger & Voigt (1988) oder Buck (1994, 1996)). Für das „Verstehen durch in Worte fassen“ (ten Voorde, 1994) schlägt Müller als Alternative zum gängigen Chemieunterricht das „synoptisch-soziale Lernen“ (in Anlehnung an Buck 1994) vor, den man ausführlicher als „zusammenschauendes und zugleich einander sozial wahrnehmendes Lernen“ beschreiben müsste. Solches zusammenschauendes und sozial wahrnehmendes Lernen wird in der genetischen-sokratischen-exemplarischen Methode von Wagenschein (1968) verwirklicht. Wir nennen es daher in Anlehnung an den Buchtitel „Verstehen lehren“ von Martin Wagenschein „verstehendes Lernen“.
„Ein Exempel (Phänomene, Begriffe, Prozesse, Strukturen), das so gewählt ist, dass es auf das Ganze des Fachs ausstrahlen kann (in Anlehnung eines Wagenschein-Zitates, Anm.) soll bei den Lernenden den emotionalen Motor in Gang setzen. Schülerinnen und Schüler werden durch das Exempel affiziiert [angeregt] und aporethisch-fragend [vorerst unbestimmt-fragend] gestalten sie im sokratischen Aushandlungsprozess (...) ihren je individuellen Lernprozess... „ (Müller 1997, S. 41).
Dem Einwurf der Kritiker, die synoptisch-soziale Lernform führe zu einem Verlust der Wissenschaftsorientierung, tritt Müller mit der Argumentation entgegen: Diese Lernform verzichte bewusst auf die vollständige Vermittlung aller vermeintlich festgefügten Kenntnisse, um exemplarisch in einzelnen, ausgewählten Unterrichtsbeispielen das „Elementare der Zusammenhänge“ zu lernen. Ziel sei nicht das häufig praktizierte, sture Übernehmen und Auswendigpauken von Wissen, sondern die Anregung zu eigenständigem Denken und zum wirklichen Durchdringen und Verstehen einer Sache und der Sinnzusammenhänge. Dies sei ein Gewinn von Kenntnissen, die nicht schwinden. Die Methode sei immer auch auf das moralische Handeln des Lernenden gerichtet, da sie immer in die oben beschriebene dialogisch-diskursive Erziehung eingebunden sei.
Dies gilt auch für den unverzichtbaren
„Experimentalunterricht“ der naturwissenschaftlichen Fächer. Im naturwissenschaftlichen
Unterricht ist eine Neubewertung der experimentellen und instrumentellen
Maßnahmen zum Erkenntnisgewinn notwendig. Begriffe sollten nicht
nur einfach vorgegeben werden, sondern sie werden gemeinsam mit den Schülern
in der Betrachtung von praktischen Experimenten und theoretischen Gedankenexperimenten
ausgehandelt.
„Durch diesen Aushandlungsprozess
in einer Gemeinschaft erleben die Schülerinnen und Schüler das
Wachsen der Zusammenhänge, der Strukturen, der Begriffe, der Phänomene
und Prozesse. Sie erleben das Elementare des Exempels.“ (Müller 1997,
S. 41).
Da im Chemieunterricht über chemische Phänomene gesprochen werden muss, ist das, was man landläufig „Experiment“ nennt, angesagt. Leider wird dieser Begriff im Chemieunterricht störend verwaschen verwendet, wenn von „Schülerversuch“ oder von „Schülerexperiment“ die Rede ist.
Aus diesem Grunde möchte ich lieber
eine klarere Begriffsabgrenzung vornehmen: Experimentelle Maßnahmen
können in (mindestens) 4 Bereiche gegliedert werden. Dabei spielt
die Initiation, welche tiefgehendes Staunen auslöst, eine entscheidende
Rolle:
a) Initiation:
Ermöglichung des Anfangs von verstehendem
Lernen im Sinne Wagenscheins
b) Experiment im engeren Sinn:
Systematisch-empirische Beantwortung einer
Fragestellung
c) Schülerübung:
(Re)Produktives Anwenden von instrumentellen
Arbeitsweisen, gelegentlich auch Erzeugung von Phänomenen
d) Demonstration:
Es soll ein Phänomen, ein Effekt,
eine Wirkung gezeigt werden. Beispiel: Zink reagiert mit Schwefel; es gibt
eine Stichflamme
Die in der Schulpraxis des Chemie- oder
Physikunterrichts gängigen Schülerübungen ermöglichen
zumeist kein verstehendes Lernen im eigentlichen Sinne, sondern sie üben
nur instrumentelle Arbeitstechniken ein.
Es sollte zwischen Schülerübung und Schülerexperiment deutlich unterschieden werden. Beide benötigen jedoch ihren Stellenwert im naturwissenschaftlichen Unterricht. Chemische Arbeitsverfahren wie Destillieren und Filtrieren oder physikalische Fertigkeiten wie Wiegen, Messen und Zählen werden wohl eher durch Schülerübungen einstudiert.
Für das tiefgehende Verständnis
von Natur, bzw. für das eigentliche Experimentieren ist jedoch verstehendes
Lernen notwendig. Der nachstehende Kriterienkatalog verdeutlicht den hohen
Anspruch des verstehenden und des zusammenschauend-sozialen Lernens bei
experimentellen Maßnahmen.
Kriterienkatalog
für verstehendes und zusamenschauend-soziales Lernen
1. Das Initiationsphänomen ruft tiefgehendes
Staunen hervor und erweckt den Wunsch nach einerforschenden Tätigkeit.
2. Das Phänomen spricht die Sinne
an und ist ästhetisch ansprechend.
3. Das Phänomen erzeugt eine
Fragehaltung. Die Fragen sollten durch die Schüler notiert und auchgeäußert
werden. Dabei ist zu beachten, dass die Faszination des Phänomens
durch die Fragen nicht zerstört wird. Diese beziehen sich vor allem
auf die nachfolgenden Variationsexperimente
4. Die anschließenden Experimente lassen viele Variationen zu.
5. Die Experimente und die Variationen sind einfach und ungefährlich. Sie sind von jedem Schüler und jeder Schülerin durchführbar und vom Versuchsaufbau leicht durchschaubar.
6. Die Ausgangsbedingungen sind offen. Dies gilt vor allem für die Auswahl von Variationsexperimenten. Die Zeit zum Experimentieren ist sehr großzügig bemessen. Lösungen dürfen nicht vorgegeben werden.
7. Es darf keine schriftliche Arbeitsanleitung oder ein Arbeitsblatt vorliegen: Versuchsanleitungen erfolgen in der Initiationsphase oder punktuell bei der Einführung von Variationsmöglichkeiten durch mündliche Mitteilungen oder kurze Vorführungen durch den Lehrer oder durch andere Arbeitsgruppen.
8. Das Aushandeln der Begriffe und der Erkenntnisse erfolgt durch das Gespräch zwischen allen Beteiligten.
9. Bei den Versuchen und im Gespräch sehen sich im Idealfall alle gegenseitig (Kreisanordnung der Tische). Es gelten folgende Gesprächsregeln:
a) Sieh die sprechende Person an!
b) Höre ihr zu und sprich nur, wenn
du an der Reihe bist!
c) Orientiere dich an zuvor geäußerten
Meinungen, wenn du dich äußerst!
d) Führe aber auch neue Standpunkte
ein oder zeige andere Lösungsmöglichkeiten auf!
e) Schildere alles, was du mit deinen
Sinnen wahrnimmst und alles was in dir in deinen Gefühlen vorgeht!
10. Vorgeschlagene Lösungen müssen auf ihren Wahrheitsgehalt argumentativ und wenn möglich experimentell überprüft werden.
11. Die Experimente sollten durch die Schüler schriftlich protokolliert werden. Als Inhalte sollten sie dabei berücksichtigen:
- Beschreibung des Phänomens, der Problemstellung oder der Anfangshaltung
- Erstellung eines Fragekatalogs: „Mir stellen sich folgende Fragen...“
- Beschreibung aller durchgeführten Experimente und Variationen (schriftlich und
- zeichnerisch) in Verbindung mit Antworten, welche sich ergeben haben.
„Ich habe mich dabei so gefühlt...“
- Schriftliche (und auch mündliche) Reflexion:
„Diese Art von Unterricht fand ich...“
Hierbei ist kritisch anzumerken, dass die Schulwirklichkeit - mit den großen Klassen und den einstündigen Fächern - dieses Prinzip nicht fördert. Es sind nur wenige Experimente im Chemieunterricht geeignet, welche diese Grundanforderungen erfüllen. Als Beispiele nenne ich die Petrischalenversuche wie sie de Vos (1990) vorgestellt hat oder Faradays „Naturgeschichte einer Kerze“ (Theophel 1995).
Das Experiment kann jedoch nur einen Teilbereich des Chemieunterrichts darstellen. Die Schülerübung fördert das pragmatische, das Initiationsexperiment das verstehende und der Frontalunterricht das systematische Wissen.
Für Schulabgänger sind in einem
so aufgeweiteten und bedeutsam gewordenen Unterricht Testate mit differenzierten
Aufschlüsselungen der erreichten Grundqualifikationen denkbar. Es
könnte „Scheine“ für pragmatische, für experimentelle oder
für das Ausmaß an Ich- und Sozialkompetenz geben. Letztere sind
vor allem aus der Ausarbeitung einer naturwissenschaftlichen Dokumentation
ersichtlich, wenn Schüler in Gruppenarbeit eine Arbeit erstellen.
Alle Vorhaben müssten möglichst so gewählt werden,
dass ein möglichst gleichrangiger Anteil aller Kompetenzen Geltung
findet.
5. Kritische Hinterfragung des Erkenntnisweges im Hinblick auf das Modelldenken im naturwissenschaftlichen Unterricht (These 5)
Obwohl eigentlich seit langem unstrittig ist, dass unsere alltäglichen Anschauungen nicht für die Welt der Atome passen, hat sich vor allem in der Chemiedidaktik so etwas wie ein „Positionenstreit“ (vgl. Seilnacht 1998, Fischler 1998) aufgetan. Der frühzeitige Einsatz von anschaulichen Modellen zerstört, wie ich mit einer Reihe anderer Kollegen (etwa Buck & von Mackensen 1996, Kapitel 9) meine, den Bezug zur Wirklichkeit. Wenn bildhafte Vorstellungen (Imaginationen) von innen hervorgerufen werden, bzw. in den Gedanken entstehen, wird eine Verwurzelung mit den Dingen erzeugt. Jedes sichtbare, von außen gegebene Bild zerstört aber diese Imaginationen und reißt Wurzeln aus. Ein Dichter, der eingängige Metaphern einsetzt, überzeugt nicht, wenn seine metaphorischen Bilder aus dem möglichst abstrusen Zusammenspiel von Gewohntem und Andersartigem Kraft schöpfen. Dies ist eine alte Regel der Lyriker (vgl. Waldmann 1994).
Naturwissenschaftliches Denken ist weitgehend Modelldenken. Die Einführung in das Modelldenken ist jedoch mit größter Vorsicht vorzunehmen. Sobald konkrete, spezielle und abbildhafte Modelle der Wirklichkeit im Anfangsunterricht eingesetzt werden, wird den Schülern und Schülerinnen der Zugang zu diesem Modelldenken verbaut, so paradox dies erscheint . Der Grund ist darin zu sehen, dass das Modelldenken die Wirklichkeit mit Hilfe von Denkkonstruktionen beschreibt. Der Lernende muss die Prinzipien dieser von der erfahrbaren Wirklichkeit abweichenden, sprunghaften Konstruktionen innerlich nachvollziehen können. Anschauliche Modelle suggerieren jedoch scheinbar einfache Wahrheiten und Erklärungen, deshalb setzen sie die Lehrer vielleicht auch so gerne ein. Die Gefahr ist, dass sich die Schüler ein zu einfaches und bequemes Bild von der Wirklichkeit machen, von dem sie nicht mehr loskommen und damit den „Sprung“ in die „Andersweltlichkeit“ (Fladt 1996) verpassen.
In seinen kritischen Anmerkungen zur Phänomenologie Wagenscheins warnt Dahlmann vor einer Überstrapazierung der Phänomene und deren Erklärungsversuche im naturwissenschaftlichen Unterricht (Dahlmann 1996):
„Erst wenn alle Fragen aufhören, kann das reine Phänomen geschaut werden, es ist unhinterfragbar und evident. Diese Schau ist eine Wesenseinsicht intuitiver Art, die keine Begriffe mehr benötigt. Sie ist nur sie selbst. Die Schau und das Phänomen sind eins.“ (Dahlmann 1996, S. 284)
Mit den Phänomenen verhält es sich ähnlich wie mit den Modellen: Es ist zu bedenken, dass jeder Erklärungsversuch die Faszination des Phänomens zerstört, wie wenn ein Zauberer seinen Trick verrät. Trotz allem möchte ich behaupten, dass die Naturphänomene der Natur ein wesentliches Stück näher sind als das Modelldenken. Aus diesem Grunde werden die Schüler das naturwissenschaftliche Modelldenken niemals nachvollziehen, wenn die Naturphänomene nicht im Anfangsunterricht „geschaut“ und unmittelbar erlebt wurden, da ihnen der Bezug zur Wirklichkeit fehlt. Weil Physik- und Chemie oft nicht frühzeitig (in den Klassen 5 bis 7) beginnen kann, sondern erst ab Klasse 8 unterrichtet wird, erfolgt das Erleben der Phänomene dann meist im Schnelldurchgang. Bereits am Ende des ersten Schuljahres sollen die Schüler dann das Modelldenken erlernt haben.
Die Problematik des Modelldenkens kann auch anhand der physikalischen und philosophischen Erkenntnisse aus der Quantenphysik erläutert werden. Bekannte Versuche zeigen, dass Elementarteilchen (z.B. Lichtquanten) je nach Versuchsanordnung als Teilchen oder als Wellen interpretiert werden können. Es kommt auf die „Wahrnehmungsbrille“ an und wie wir an das zu untersuchende Objekt herangehen. Verwenden wir nur eine Wahrnehmungsbrille, erhalten wir auch nur eine einzige Vorstellung aus der vielschichtigen Wirklichkeit. Niels Bohr und die Kopenhagener Schule prägten für das gleichzeitige Existieren zweier verschiedener „Wahrheiten“, mit denen man leben muss, den Begriff der Komplementarität (vgl. Scheibe 1989, S. 380 ff.). Sie forderten daher auch eine genaue Beschreibung der Versuchsanordnung bei allen naturwissenschaftlichen Experimenten.
Soll naturwissenschaftliches Modelldenken eingeführt werden, muss der Erkenntnisweg transparent gemacht und problematisiert werden. Dann wird auch verständlich, dass bei unseren Vorstellungen über das Atom durchaus mehrere Modelle nebeneinander existieren können, denn das Atom zeigt sich in verschiedenen Gestalten. Entscheidend dabei ist, dass wir den Aufbau der Versuchsanordnung, die uns Aufschlüsse über den Atombau liefern soll, genau beschreiben müssen. Im Unterricht etwa: Vor der Einführung des Rutherfordschen Atommodells sollte zuerst eine ausführliche Einführung in den Systembegriff und in die eigentümliche Andersartigkeit der Atome erfolgen. Denn sonst meinen die Schüler womöglich wirklich, die Atome seien farbige Kügelchen. Erst danach erfolgt eine Beschreibung der Versuchsanordnungen, welche Aussagen über den Atombau zulassen.
Ein derartiger Anfangsunterricht kann und
darf, wenn er denn zur Einwurzelung führen soll, sich nur an Natursystemen
der konkreten Wirklichkeit orientieren, erst dann (wenn überhaupt)
ist eine Abstraktion zu Atommodellen in der Reichweite des verstehenden
Wissens. Buck (1981) verwendet beispielsweise den Aufbau und die Funktion
eines Hühnereies und erarbeitet an ihm den Systembegriff. Die „Andersweltlichkeit
der Atome“ (Fladt) lässt sich freilich genauso anhand des menschlichen
Körpers erläutern: Eiweiß, Fett und Zucker sind zwar Systemkomponenten
des menschlichen Körpers, sie besitzen jedoch ganz andere Eigenschaften,
wie sie dem Menschen als Ganzes zuzuschreiben sind. So besitzen Atome keine
Farbe, obwohl das funktionierende System, welches sie bilden - beispielsweise
eine Tomate - rot erscheint, sie sind „andersartig“.
Konsequenzen:
Abbildhafte Modelle wie das Teilchenmodell
sind stark konstruierte Bilder von der Wirklichkeit. Sie sollten im Anfangsunterricht
nicht mehr eingesetzt werden, stattdessen empfiehlt sich, die Atome möglichst
spät mit Hilfe des Systembegriffs und in ihrer Andersartigkeit
einzuführen. Das Prinzip der Andersartigkeit gilt nicht nur für
die Welt der Atome, sondern auch für Wahrnehmungsprozesse. Jede Wahrnehmung
ist „andersartig“, wenn sie sich vom eigenen, egozentrischen Standpunkt
loslöst, da sie dann um den Blickwinkel der nach außen wirkenden
Beziehungsfunktion erweitert wird. Um sich vom Egozentrismus eines durch
Wahrnehmungen stark eingeschränkten Weltbildes zu lösen, müssen
der Erkenntnisweg und alle dabei auftretenden funktionalen Beziehungsverhältnisse
transparent gemacht werden, dann lernen wir, über die Vielfalt und
Widersprüchlichkeit der Natursysteme zu staunen. Natursysteme sind
äußerst komplex und können nicht ohne ihre innere und äußere
Beziehungsstruktur existieren. Ein Atom als (mathematisches) Individuum
ist nicht denkbar ohne die in seinem Inneren wirkenden funktionalen Beziehungen
seiner Komponenten und ohne die von außen wirkenden Kräftebeziehungen.
6. Komplementäres Denken als neues Paradigma zur Überwindung des ausschließlich kreisförmig-logischen Denkens (These 6)
Das komplementäre und gleichzeitige Existieren von Elementarteilchen als Teilchen und als Welle ist ein Beispiel dafür, dass vorläufig widersprüchliche Erscheinungen durchaus nebeneinander existieren können, ohne sich gegenseitig zu widersprechen. Dieses Prinzip ist aber durchaus nichts neues, es entspricht dem Yin- und Yang-Prinzip der chinesischen, nahöstlichen Philosophie. Der Begriff der Komplementarität wurde nicht nur von den Naturwissenschaftlern der Kopenhagener Schule aufgenommen, sondern auch von den Konstruktivisten wie Heinz von Foerster (1992, S 41. f).
Zur Verdeutlichung, was gemeint ist, möchte ich mehrere Begriffspaare gegenüberstellen, die in einer komplementären Beziehung zueinander stehen:
a) Selbständiges und Einbezogenes
b) Wahres und Falsches
c) Altes und Neues, Nahes und Fernes,
Sichtbares und Unsichtbares
zu a) Selbständiges und Einbezogenes
Dieses komplementäre Begriffspaar ist das wohl bekannteste. Dem chinesischen Yang-Prinzip entspricht die Selbstbehauptung, das Yin-Prinzip verfolgt eher Integration. Beide Prinzipien bedingen sich in lebenden Systemen der Natur gegenseitig, in funktionierenden Ökosystemen halten sie sich im Gleichgewicht. Jede Einseitigkeit führt am Ende zu einer Störung im Gesamtsystem. Verhält sich eine Rasse oder eine Tierart so, dass sie nur ihre eigenen Interessen egoistisch wahrnimmt, dann zerstört sie die Lebensgrundlagen - die im Grunde genommen auch ihre eigenen sind - der anderen Mitglieder im Ökosystem und stirbt aus. Verändern sich die Umweltbedingungen plötzlich, ist sie nicht anpassungsfähig genug, um sich auf die neuen Bedingungen einzustellen. Dieses Verhalten trifft auf den Menschen des Industriezeitalters zu. Übersieht die Rasse ihre eigenen Interessen, verliert sie ihre Eigenständigkeit und wird von jemand anderem gefressen oder verdrängt. Man kann sagen, dass Selbständigkeit und Einbezogenheit sich gegenseitig bedingen und komplementär zueinander stehen (Eine andere Begründung liefert Foerster, 1982, S. 41f).
Dieses Prinzip gilt nicht nur für lebende Systeme, sondern generell für alle Natursysteme: Atome sind zählbar, d.h. sie sind im mathematischen Sinne individuell abgegrenzte Systeme, wie Dahlmann bewiesen hat (Dahlmann 1979), sie besitzen aber gleichzeitig die Eigenschaft, sich in andere Systeme integrieren, diese zu „durchdringen“ oder sich selbst verändern zu können. Sie sind also nicht eindeutig fassbar. Das Atom ist und es ist nicht (ein Individuum).
zu b) Wahres und Falsches
Grundlage für komplementäres Denken ist die Tatsache, dass eine Erscheinung niemals ohne ihre eigene Gegensätzlichkeit existieren kann. Dies soll im folgenden auf den Prozess der Erkenntnisgewinnung bezogen werden.
Nach Karl Popper können wir eine Aussage oder eine Theorie immer dann als wahr bezeichnen, wenn wir uns eine Vorstellung von ihrer Widerlegung machen können, bzw. wenn wir nicht fähig sind, sie zu widerlegen. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang wesentlich weiter gehen als Popper und behaupten, dass wir zum Verifizieren einer Aussage eine Widerlegung jederzeit mit einbeziehen müssen, jede angeblich „falsche“ Aussage ist immer und gleichzeitig Bestandteil der Aussage, die wir als wahr bezeichnen. Insofern müssen wir alle widerlegten Theorien im Auge behalten, wir dürfen sie niemals vollständig ad acta legen.
Komplementäres Denken zeichnet sich dadurch aus, dass es bestehende Theorien und ihre Falsifikationen überprüft und die für wahr befundenen Inhalte zu einer neuen Theorie integriert, denn eine Sache ist nicht nur das, was sie ist, sondern auch das, was sie nicht ist. Eine Wahrheit kann nur als (subjektiv) wahr bezeichnet werden, wenn wir uns eine Negation, bzw. ein Gegenteil davon vorstellen können. Insofern existiert keine absolute Wahrheit und Objektivität, da die Negation selbst Bestandteil der Wahrheit ist, so wie das Licht gleichzeitig ein Teilchen und eine Welle (also ein „Nichtteilchen“) ist.
Ein weiteres Problem des heutigen, wissenschaftlichen Denkens liegt darin, dass es oft ein Denkgebäude erstellt, welches in sich schlüssig erscheint, solange sich die Katze in ihren eigenen Schwanz beißt:
aus a folgt b aus b folgt c aus c folgt a
Bei einer Aussage d versucht man eventuell den Schwanz der Katze um das „fehlende Glied“ zu verlängern, passt das Glied vorläufig nicht in die Kette, wird sein Verifizieren ausgeschlossen. Diese Art des logischen Denkens möchte ich als zirkuläres, quasi-logisches Denken bezeichnen. So können in sich abgeschlossene Theorien in sich schlüssig erscheinen, obwohl andere Theorien vielleicht zu ganz anderen Schlüssen kommen. Insofern müssen wir jede Theorie - auch wenn sie noch so schlüssig erscheint - mit Vorsicht behandeln. Ein Postulat des komplementären Denkens müsste folgendermaßen lauten:
Es ist zu untersuchen, unter welchen Umständen und wie eine Theorie zustande gekommen ist, dabei müssen auch die falsifizierten und ad acta gelegten Aussagen erneut berücksichtigt werden.
Komplementäres Denken darf sich aber
niemals ausschließlich auf der rational-logischen Ebene abspielen.
Dann wäre die Kritik von P. Feyerabend am wissenschaftlichen Denken
des Abendlandes durchaus berechtigt. Kreativität, Spontaneität
und Intuition besitzen im komplementären Denken neben dem rational-logischen
Denken eine gleichrangige Stellung, denn die Emotionen bilden ein komplementäres
Gegengewicht zu dem Verstand und können eine Bereicherung der Methodenvielfalt
im wissenschaftlichen Denken darstellen.
Jede Erkenntnis und jede Theorie ist also
nur innerhalb ihres Gültigkeitsbereichs, bzw. ihres Bereichs der „Wahr“nehmungsbrille
wahr. Wird die Fähigkeit zur bewussten Wahrnehmung erweitert, verliert
die Erkenntnis oder die Theorie möglicherweise ihre Gültigkeit
und muss neu überdacht werden. Dieses Neudenken ist nicht eine bloße
Widerlegung der alten Theorie, sondern es ist eine Neustrukturierung, wobei
Teilwahrheiten durchaus nebeneinander weiter existieren können oder
alte, bisher als falsch geltende Aussagen plötzlich wieder an Bedeutung
gewinnen. Die Frage dieses neuen Paradigmas lautet nicht mehr „Ja oder
nein?“, sondern „Ja und nein?“.
c) Altes und Neues, Nahes und Fernes,
Sichtbares und Unsichtbares
Zur Schärfung der Wahrnehmungsfähigkeit
werden oft optische Täuschungen herangezogen. Sie zeigen uns auf,
dass wir an der Konstruktion unseres Wirklichkeitsbildes selbst beteiligt
sind. Sie schulen komplementäres Sehen, da sie uns - in begrenztem
Maße - einen Spiegel des normalerweise Nicht-Sichtbaren vorhalten.
Sie zeigen, dass unsere Wahrnehmung von bereits gemachten Erfahrungen abhängt.
Wir sehen in dem nebenstehenden Bild je nach Betrachtung ein Gesicht oder
eine Vase. Beide Gegenstände erkennen wir, da wir sie real schon einmal
gesehen haben. Auch hier verhalten sich die neuen Wahrnehmungserfahrungen
komplementär zu den alten.
Komplementäres Sehen berücksichtigt
sowohl, was wir bei einer Erscheinung augenscheinlich sehen als auch, was
wir nicht sehen, es führt deshalb immer zur Erkenntnis, was hinter
dem Augenscheinlichen steckt. Das Unsichtbare muss in einem komplementär
denkenden Menschen höchste Neugier erwecken, denn es führt letztendlich
zum Sichtbaren. Das Bild „Glas-Haus“ von Magritte zeigt die Rückseite
eines Schädels, aus dem aus einer Öffnung die Vorderseite
des Gesichts herausblickt. Der Betrachter sieht gleichzeitig die Vorder-
und Hinterseite der Kopfes, während in der realen Welt die beiden
Seiten nur als Betrachtbares und und Nichtbetrachtbares existieren. Durch
dieses Transparent-Machen der Wirklichkeit erfolgt keine vollständige
Annäherung an die Wirklichkeit, dafür findet jedoch eine prozesshafte
Vertiefung in die Dinge statt: Die Wirklichkeit bleibt immer transparent,
das reflektierte Wissen um unser Selbst nimmt aber zu.
Konsequenzen:
Die Gültigkeit des komplementären Prinzips und seiner Konsequenzen wurde an den verschiedenen Begriffspaaren und Beispielen überprüft. Es erscheint so, als ob das komplementäre Prinzip ein Grundprinzip der Natur darstellt, welches allen Dingen zugeeignet ist. Wenn es so ist, dann sollte auch im Unterricht und im Umgang mit den Menschen das komplementäre Denken geschult werden.
Ausgangspunkt war die Kritik am bestehenden naturwissenschaftlichen Unterricht, der vor allem das systematische Fachwissen überbewertet. Das verstehende Wissen, welches berücksichtigt, wie das Wissen zustande gekommen ist (Wagenschein), wird nur selten vermittelt, Ich- und Sozialkompetenz wurden bisher viel zu wenig als Bildungsziele für einen naturwissenschaftlichen Unterricht formuliert. Der Unterricht geht durchweg an der Lebenserfahrung der Schüler vorbei und stellt keine vernetzenden Bezüge bei Begriffen her. Wissen wird nicht er-lebt, sondern findet nur in den Köpfen statt. Die Ursache dafür ist in einer Überbewertung und Zentrierung des letztlich zirkulären, nur quasi-logischen Denkens zu sehen, z.B. bei dem Lehrer, für den die Fachwissenschaft ein geschlossenes Gebäude darstellt.
In der Quantentheorie ist eine genaue Offenlegung der Bezugspunkte und Anordnungen notwendig geworden, wenn Natursysteme beschrieben werden sollen. Es kommt immer darauf an, wer was, unter welchen Bedingungen, zu welcher Zeit beschreibt. Nach meiner Vorstellung ist dieses Postulat bei der Beschreibung aller Natursysteme, einschließlich lebender und sozialer Beziehungssysteme, zu beachten. Zum Feld der Beziehungen in der Schule gehört das ganze Umfeld, die Beziehungen zwischen Lehrern, Schülern und allen Beteiligten. Vor allem aber ist eine genaue Reflexion des Selbstbildes der Schüler und der Lehrkräfte notwendig. Erst das Bewusstmachen der Beziehung des eigenen Ichs zum Du (Buber) führt zu einer Überwindung der Egozentrik.
Die Analogisierung zwischen der materiellen und der sozialen Welt führt zur Forderung nach einer Verknüpfung der Naturwissenschaft mit allen anderen „Wissen“schaften über den Menschen und der Natur, einschließlich der Pädagogik und der Philosophie. Komplementäre Bildung fördert den Menschen in seiner Ganzheit als pragmatisch und moralisch handelndes Wesen innerhalb der Systeme der Natur. Für die Unterrichtspraxis an den Schulen bedeutet dies, dass es keine Fachwissenschaft mehr geben kann, welche von erzieherischen und ethischen Fragen losgelöst ist. Fachdidaktische Veröffentlichungen, die den Anspruch erheben, für die Unterrichtspraxis von Nutzen zu sein, müssten in Zukunft darauf überprüft werden, ob sie das Feld der sozialen Beziehungen der Lehrenden und Lernenden ausreichend berücksichtigt haben.
Wenn diese Ideen sich durchsetzen sollen, ist eine permanente wissenschaftstheoretische Neubewertung von Begriffen notwendig. Begriffe wie „Atom“, „Stoff“, „Didaktik“, „Bildung“, „Erziehung“ oder „Naturwissenschaft“ müssten immer wieder neu ausgehandelt werden. Gleichzeitig können die alten Begriffe zunächst im Sprachvokabular durchaus weiterverwendet werden. Begriffe können ja sowieso nie für alle Zeiten gültig festgeschrieben werden, sie ändern sich im Laufe der Zeit und erhalten immer wieder neue Bedeutungszusammenhänge. Eine bedeutende Unterrichtsform zum Aushandeln von Begriffen ist das verstehende Lernen am Experiment.
Der begrifflichen Neubewertung sollte eine konsequente Neuorientierung der Schule und aller Ausbildungsinstitutionen folgen. Nicht nur „neue Unterrichtsmethoden“ sind gefragt, sondern offene Theorien über Unterricht und vor allem das neue Menschenbild des zum Dialog bereiten Erziehers und Ausbilders. Ich würde etwa folgende Neuorientierungen für den bisherigen naturwissenschaftichen Unterricht fordern:
Die vorhandenen Fächer Chemie, Physik und Biologie sollten stärker integriert werden. Außerdem wäre eine Vernetzung mit anderen Fachbereichen, insbesondere mit Ethik, Kunst, Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde zu fordern. Physik und Chemie sollten in allen Klassenstufen durchgehend unterrichtet werden, sonst entsteht ein Bruch, der nicht zu vertreten ist.
Der Schwerpunkt des Fachunterrichts sollte nicht mehr einseitig auf Systematik gelegt werden. Der exemplarische Unterricht sollte noch mehr an Bedeutung gewinnen. Komplementäre Bildung bedeutet auch, dass Schüler eine Vielfalt an Angeboten erhalten und gleichzeitig auch lernen, sich in bestimmte Gebiete, die sie vielleicht besonders interessieren, zu vertiefen. Diese beiden entgegenstehenden Prinzipien sollten in längeren Projekten zu verschiedenen Themengebieten verwirklicht werden. Projekte im Bereich Naturwissenschaft müssten immer auch ethische und philosophische Fragen tangieren.
Das Bild der Lehrperson als reine Wissensvermittlerin sollte aufgegeben werden. Wer in Schule und Ausbildung lehrt und lernt, hat es mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zu tun, mit denen man sich im Dialog auseinandersetzen muss. Der Dialog ist zum Aushandeln von Moralbewusstsein und von begrifflichen Grundlagen notwendig, deshalb müsste auch dafür gesorgt werden, dass alle Beteiligten aktiv in den Unterricht in Form von Gesprächen und Handlungssituationen eingebunden werden. Die zum Dialog bereite Lehrperson sollte sich der (manipulativen) Wirkung ihrer Persönlichkeit bewusst sein und ein reflektiertes Selbstbild besitzen. Erst dann ist gewährleistet, dass sie ihre Autorität und Vorbildfunktion nicht missbraucht.
Unterrichtsmethoden wie zum Beispiel die
Freiarbeit, das Streitgespräch, das Rollenspiel oder die Projektmethode
sind für eine Demokratisierung der Schule geeignet. Das reflektierte
Bewusstmachen von eigenen Standpunkten und von Beziehungsmustern spielt
eine besondere Rolle. Reflexion über Unterricht kann in Gesprächen
oder in schriftlichen Berichten erfolgen, die sich Schüler und Lehrer
gegenseitig austauschen. Es fördert das komplementäre Denken
in besonderem Maße.
- Böhme, H.: Wasser - oder von der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels, In: P. Buck und E.M. Kranich (Hg.): Auf der Suche nach dem erlebbaren Zusammenhang, Weinheim/Basel, Beltz-Verlag (1995)
- Buck, P.: Eine Unterrichtseinheit über die Natur der Atome, In: chimica didactica 7 (1981) S. 5-25
- Buck, P.: Verstehen lehren statt Begriffe einprägen, In: Chemie in der Schule 40 (1993) 4, S. 134-139
- Buck, P.: Die Teilchenvorstellung - ein „Unmodell“, In: Chemie in der Schule 41 (1994) 11, S. 412-416
- Buck, P.: Wie kann man die Andersartigkeit der Atome lehren?, In: Chemie in der Schule 41 (1994) 12, S. 460-469
- Buck, P.: Naturwissenschaftlicher Unterricht in der Realschule - Entwicklungen und
- Visionen - Chemie, In: Forum Realschule 1995, Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart (1995), S. 86-88
- Buck, P.: Einwurzelung und Verdichtung, Dürnau, Verlag der kooperativen Dürnau (1997)
- Buck, P. & Fladt, R.: Ein Dialog über die Funktion der Teilchenmodelle im Chemieunterricht, In: Chemie in der Schule 43 (1996) S. 69-72
- Buck, P. & von Mackensen M.: Naturphänomene erlebend verstehen, Köln, Aulis-Verlag 6. Aufl. (1996)
- Buck, P.: Stoff als Stoff - von der wirklichkeitsauflösenden Wirkung des herkömmlichen präzisen Stoffbegriffs und den Schwierigkeiten, einen exakten, existenzialrelevanten Stoffbegriff zu entwicken. In: chimica didactica 20 (1994) S. 222-236
- Dahlmann, W.: Zur Protochemie der Stoffmenge als Teilchenzahl, In: chimica didactica 5 (1979), S. 215-230
- Dahlmann, W.: Am Ende des langen Weges sind wir im Besitz des Atoms. Aber: das nun gefundene Ding ist der Weg selber, In: chimica didactica 3 (1996), S. 272-295
- Dahlmann, W.: Vorbild versus Moderator, sollen Erkenntnisse und Werte in der Schule ausgehandelt werden? Stellungnahme zu Markus Müllers Beitrag, In: chimica didactica 1 (1998), S. 60-74
- Danner, J.: Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik, München, Ernst-Reinhardt-Verlag (1998)
- Fischler, H.: Schüleraussagen und Wunschdenken. Unterricht Physik 9 (1998), Nr. 44 S. 42 (92) und Unterricht Physik 8 (1997) Nr. 41 S. 40
- Foerster, H. von: Entdecken oder Erfinden, Wie lässt sich Verstehen verstehen? In: Einführung in den Konstruktivismus, Piper-Verlag, München 1992
- Habermas, J.: Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt a. M., Suhrkamp-Verlag (1983)
- Habermas, J.: Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt a. M., Suhrkamp-Verlag (1991)
- Kant, I.: Kritik der praktischen Vernunft, Hamburg, Felix-Meiner-Verlag (1990)
- Klafki, W.: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Beltz-Verlag, Weinheim 1985
- Kranich, E.M.: Wasser ist sicher mehr als H2O, In: P. Buck und E.M. Kranich (Hg.):
- Auf der Suche nach dem erlebbaren Zusammenhang, Weinheim/Basel, Beltz-Verlag (1995), S. 62-72
- Messner, R., Rumpf, H. und Buck, P.: Natur und Bildung - über Aufgaben des natur-
- wissenschaftlichen Unterrichts und Formen des Naturwissens, In: chimica didactica 1 (1997), S. 5-31
- Müller, M.: Emotionale Defizite als Hemmschwelle bei der Entwicklung von ICH-Stabilität, Diplomarbeit an der PH-Heidelberg, 1995
- Müller, M.: Zur Frage der Autonomie und der Berücksichtigung persönlicher Präferenzen der Schüler und Schülerinnen in Gerda Freises Konzeption „Lernbereich Natur“ sowie Bedenken zu Peter Bucks „engagierte Einseitigkeit“, In: chimica didactica 1 (1996), S. 84-93
- Müller, M.: „Erziehung“ in einer vom Fachwissen dominierten Schulpraxis?, In: chimica
- didactica 1/1997, S. 32-62
- Münzinger, W. und Voigt, J.: Routine und Reflexion, In: Die Deutsche Schule 80 (1988), S. 351-369
- Oser, F., Althoff, W.: Moralische Selbstbestimmung: Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich, Stuttgart, Klett-Cotta-Verlag (1997)
- Rumpf, H.: Wasser, das unbekannte Wesen - einige Ideen für spielerische Übungen, Einstiege, Inszenierungen anfänglicher Aufmerksamkeit, In: P. Buck und E.M. Kranich (Hg.): Auf der Suche nach dem erlebbaren Zusammenhang, Weinheim/Basel, Beltz-Verlag (1995), S. 50-52
- Scheler, M.: Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bonn, Bouvier-Verlag (1995)
- Seilnacht, T.: Freiarbeit im Unterricht der Sekundarstufe, exemplarisch aufgezeigt für das Fach Musik, Praxis - Materialien - Planung (PMP) 5-10, Musik, Rhein-Neckar-Verlag 1. Lf. I/1996, S. I/1-I/34
- Seilnacht, T.: Düngemittel zum Wohle der Menschheit? Ein Rollenspiel für die Sekundarstufe?, In: chimica didactica 3 (1995), S. 200-214
- Seilnacht, T.: Der Positionenstreit um den Atombegriff, In: Chemie in der Schule 45 (1998), S. 111-114
- Seilnacht, T.: Farben nach alten Rezepten, In: Unterricht Biologie 6 (1998), S. 50-51 und Beihefter S. 12
- Scheibe, E.: Die Kopenhagener Schule, In: G. Böhme (Hg.), Klassiker der Naturphilosophie, München, C.H. Beck-Verlag (1989)
- Stettler, P.: Naturwissenschaft und Sprache, In: Pädagogisches Forum 8 (1995), S. 194-199
- Theophel, Eberhard: Kerze, In: Berg/Schulze: Lehrkunst - Lehrbuch der Didaktik, Neuwied, Kriftel, Berlin, Luchterhand-Verlag (1995)
- ten Voorde, H.H.: Verständnis des chemischen Stoffbegriffs mit Hilfe des Prinzips ‘Element’, In: Chemie in der Schule 41 (1994), S. 137 ff.
- de Vos, W.: Vernachlässigte Aspekte des Reaktionsbegriffs im Anfangsunterricht des Fachs Chemie, In: M. Minssen (Hg.): Strukturbildende Prozesse bei chemischen Reaktionen und natürlichen Vorgängen, Kiel, IPN (1990), S. 37-85
- Wagenschein, M.: Ursprüngliches Verstehen und exaktes Denken, Stuttgart, Klett-Verlag (1965)
- Wagenschein, M.: Verstehen lehren, Weinheim/Basel, Beltz-Verlag (1968)
- Waldmann, G.: Produktiver Umgang mit Lyrik, Baltmannsweiler, Schneider-Verlag (1994)