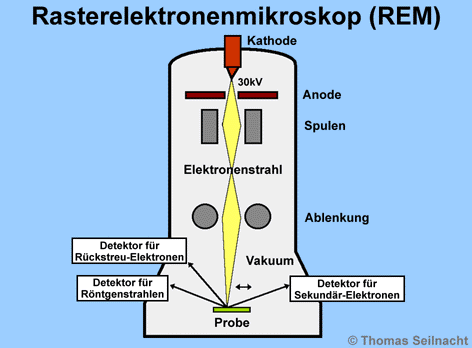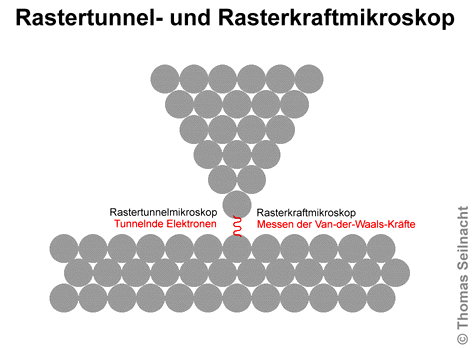Bereits
die alten Römer verwendeten zum Färben von Glas kolloidales Gold
oder Silber. Die tiefrote Färbung der Glasfenster in den Kirchen und
Kathedralen beruht ebenfalls auf fein verteiltem Gold, das bei der Herstellung
von Goldrubinglas zugemischt wird. Je nach Partikelgröße erscheinen
die Goldteilchen bei 20 Nanometer rot, größere mit 150 Nanometer erscheinen dagegen violett
oder blau [Lit
2].
Bild vergrößern
In dem Glas befindet sich kolloidales Gold und Wasser.
Direkt nach der Herstellung erschienen die Goldpartikel rot.
Auf dem Bild rechts ist das gleiche Glas zwei Jahre später zu sehen.
Das rote Gold war schon den Alchimisten im Mittelalter bekannt. Der Begriff Kolloid geht auf den englischen Physiker Thomas Graham (1805–1869) zurück [Lit 3]. Er experimentierte mit Stoffen und Lösungen, die durch Pergamentpapier diffundierten. Dabei entdeckte er, dass die „kolloidalen Substanzen“die Membran nicht passierten, während die „kristalloiden Substanzen“ hindurchgingen. Graham führte das Phänomen noch auf eine chemische Eigenschaft der Stoffe zurück. Nach dem heutigen Verständnis hängt es aber von der Größe der Teilchen ab und nicht von den chemischen Eigenschaften der Substanzen. Der österreichisch-ungarische Chemiker Richard Zsigmondy (1865–1929) bekam im Jahr 1925 den Nobelpreis für Chemie für die „Aufklärung der heterogenen Natur kolloidaler Lösungen“.
Zsigmondy entwickelte auch zusammen mit dem deutschen Physiker Henry Siedentopf (1872–1940) das Ultra-Mikroskop. Das Auflösungsvermögen eines gewöhnlichen Lichtmikroskops ist aufgrund der Wellennatur des Lichts und der auftretenden Beugungsphänomene begrenzt, so dass man bestenfalls noch Objekte unterscheiden kann, die etwa 0,2 µm voneinander entfernt sind. Beim Ultra-Mikroskop wird in dunkler Umgebung ein Lichtstrahl senkrecht auf die kolloidale Suspension fokussiert. Dabei entstehen Beugungsringe, die im mikroskopischen Abbild als helle Flecken vor dem dunklen Hintergrund erscheinen. Diese Flecken bilden Teilchen bis zu einer Größenordnung von etwa einem Nanometer ab. Das Ultra-Mikroskop ist – wie auch das durch Ruska und Knoll entwickelte Elektronenmikroskop (1931) – ein Gerät, das nicht mehr das direkte Abbild der Natur zeigt, sondern nur noch den "Schatten" eines Objekts, der durch eine experimentelle Anordnung erzeugt wird. Obwohl dieser Schatten nur ein virtuelles Abbild der Naturobjekte darstellt, kann man daraus bestimmte Eigenschaften interpretieren, was von technischem Nutzen ist.
Beim Rasterelektronenmikroskop
(REM) wird im Vakuum über ein Objekt ein durch Magnetspulen
oder Kondensatoren fokussierter Elektronenstrahl mit Hilfe einer Ablenkungseinheit
geführt („gerastert“). Die dadurch erzeugten elektrischen Signale
– in Form von aus dem Objekt austretenden Elektronen und Röntgenstrahlen
– werden gemessen und daraus lässt sich ein „Bild“ rekonstruieren.
„Farbige“ Bilder sind immer im Nachhinein nachkoloriert. Das Auflösungsvermögen
eines modernen Rasterelektronenmikroskops liegt bei wenigen Nanometern.
Der US-amerikanische Physiker Richard Feynmann (1918–1988, Nobelpreis Physik 1965) hielt im Jahr 1959 eine Rede, in der er eine Vision für die Miniaturisierung von technischen Geräten und Schaltkreisen in der Zukunft aufstellte. Der Japaner Norio Taniguchi verwendete im Jahr 1974 den Begriff Nanotechnologie als erster, um raue Materialoberflächen zu untersuchen. [Lit 1] Einen Durchbruch stellte die Entwicklung einer neuartigen Gruppe von Mikroskopen in den 1980er Jahren dar:
Der US-amerikanische Physiker Richard Feynmann (1918–1988, Nobelpreis Physik 1965) hielt im Jahr 1959 eine Rede, in der er eine Vision für die Miniaturisierung von technischen Geräten und Schaltkreisen in der Zukunft aufstellte. Der Japaner Norio Taniguchi verwendete im Jahr 1974 den Begriff Nanotechnologie als erster, um raue Materialoberflächen zu untersuchen. [Lit 1] Einen Durchbruch stellte die Entwicklung einer neuartigen Gruppe von Mikroskopen in den 1980er Jahren dar:
Das Rastertunnelmikroskop
wurde von dem Schweizer Physiker Heinrich Rohrer und dem deutschen
Physiker Gerd Binnig im Jahr 1981 am IBM Forschungszentrum in Rüschlikon
bei Zürich gebaut. Die beiden erhielten dafür den Nobelpreis
für Physik 1986. Ernst Ruska erhielt übrigens gleichzeitig den
Nobelpreis für das schon im Jahr 1931 entwickelte Elektronenmikroskop.
Ein Rastertunnelmikroskop besitzt im Gegensatz
zum Lichtmikroskop keine optischen Linsen, sondern es fährt mit einer
feinen Spitze über die Oberfläche von Materialien, ohne diese
zu berühren. Die Spitze besteht aus Platin oder Wolfram. Zwischen
der Spitze und dem Objekt fließt ein elektrischer Strom, der je nach
Erhebung oder Vertiefung auf der Materialoberfläche variiert. Die
Spitze fährt nur wenige Millionstel Millimeter an der Oberfläche
entlang. Das Rastertunnelmikroskop misst die Elektronen einer bestimmten
Energie auf einem Ausschnitt der Materialoberfläche. Dabei nutzt es
den Tunneleffekt: Wenn die Spitze sehr nahe an der Oberfläche entlangfährt,
verhalten sich einige Elektronen nicht nach den klassischen Gesetzen der
Physik. Sie „tunneln“ und treten vom Material in die Spitze über.
Diesen Effekt kann man messen und daraus eine Struktur der Oberfläche
des Materials rekonstruieren. Objekte, die mit dem Rastertunnelmikroskop
untersucht werden, müssen elektrisch leitfähig sein.
Das Rasterkraftmikroskop
funktioniert auch bei elektrisch nicht leitenden Materialien. Es misst
die Kräfte, die von den Atomen ausgehen. In der Regel sind es die
Van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen Atomen oder Molekülen, die
die Messspitze sehr geringfügig auslenken. Ein spezieller Controller
steuert die Spitze in äußerst kurzem Abstand über die Oberfläche
des Objekts und wertet die Ergebnisse aus. Es war übrigens auch Gerd
Binning, der zusammen mit Calvin Quate und Christoph Gerber im Jahr 1986
das Rasterkraftmikroskop entwickelte.
Wiederbeschreibbare CD (links) und Speicherchip (rechts)
Rasterkraftmikroskop Easyscan; Fotos: Thomas Seilnacht
Zur Ergänzung soll
noch hinzugefügt werden, dass es heute auch Lichtmikroskope gibt,
die das Problem der Beugung umgehen. Das zu den Fluoreszenzmikroskopen
gehörende STED-Mikroskop (Stimulated
Emission Depletion) hat einen Auflösungsbereich von wenigen Nanometern.
Bei Fluoreszenzmikroskopen werden Präparate mit einem Fluorenzfarbstoff
markiert. Ein solcher Farbstoff kann energetisch angeregt werden, nach
einem kurzen Zeitraum kann er wieder Licht abgeben, was man auch stimulieren
kann. Dieses Phänomen ist als Fluoreszenz bekannt. Durch das Abrastern
eines markierten Objekts erhält man ein Abbild der Oberfläche
durch das emittierte Fluoreszenzlicht. Ein STED-Mikroskop nutzt diese Technologie
und kombiniert sie mit der gezielten Ausrichtung von zwei Laserstrahlen,
von denen der eine die äußeren Bereiche des abgetasteten Fokusses
ausschaltet. Als Resultat wird ein nur extrem kleiner Ausschnitt dargestellt.
Herstellen von Nanomaterialien
Zur Herstellung von Nanomaterialien benötigt es spezielle Arbeitsverfahren. Dazu genügt es nicht, einen Stoff mechanisch zu bearbeiten und zu verkleinern. Das bloße Zerreiben in einer Kugelmühle reicht nicht aus, vielmehr muss verhindert werden, dass die verkleinerten Teilchen sich wieder zu größeren Einheiten zusammentun [Lit 27]. Um dies zu unterbinden, gibt man Tenside als Dispergiermittel dazu.
Herstellen von Nanomaterialien
Zur Herstellung von Nanomaterialien benötigt es spezielle Arbeitsverfahren. Dazu genügt es nicht, einen Stoff mechanisch zu bearbeiten und zu verkleinern. Das bloße Zerreiben in einer Kugelmühle reicht nicht aus, vielmehr muss verhindert werden, dass die verkleinerten Teilchen sich wieder zu größeren Einheiten zusammentun [Lit 27]. Um dies zu unterbinden, gibt man Tenside als Dispergiermittel dazu.
Kugelmühle mit Edelstahlkugeln zur Herstellung von Pigmenten:
Diese Mühle alleine kann noch kein Nanomaterial herstellen.
Das in Kugelmühlen
durch keramische Kugeln zerkleinerte Material wird auch unter "sehr
hohem" Druck kompaktiert und verfestigt. Eine andere Möglichkeit
wäre das Abschrecken von Schmelzen unter „extremen Abkühlraten“
[Lit1, S.83],
wobei nanokristalline Strukturen im erstarrten Material entstehen. Ein
relativ kompliziertes Verfahren stellt der Sol-Gel-Prozess dar. Vereinfacht
dargestellt werden dabei aus Solen – beispielsweise aus kolloidalen
Lösungen – dreidimensionale, vernetzte Strukturen erzeugt. Das
Produkt kann ein schwammartiges oder viskoelastisches Netzwerk sein, das
aus einer festen und flüssigen Phase (Gel)
oder aus einer festen und gasförmigen Phase (Aerogel)
besteht. Das System kann durch Dipole, durch Wasserstoffbrücken oder
durch elektrische Ladungen miteinander verknüpft sein.
|
Zerteilung Zerkleinerung |
Stabilisierung Strukturierung |
Ergebnis Beispiele |
| Zermahlen in Kugelmühle | Kompaktierung unter sehr hohem Druck | Nanostruktur mit höchst möglicher Dichte |
| Schmelzen durch Erhitzen | Abschrecken unter extremer Abkühlrate | Nanokristallines Material |
| Herstellen einer kolloidalen Lösung (Sol) | Sol-Gel-Prozess | Schwammartiges, viskoses Gel oder Aerogel |
Neben der Zerteilung
des Materials ist die Stabilisierung ein entscheidender Schritt. Zur Herstellung
von nanoskaligen Stoffsystemen benötigt es theoretische Modelle und
Theorien darüber, wie die Systeme aufgebaut sind. Dies eröffnet
dann wiederum Möglichkeiten, wie man experimentell vorgehen muss,
damit ein gewünschtes System entsteht.